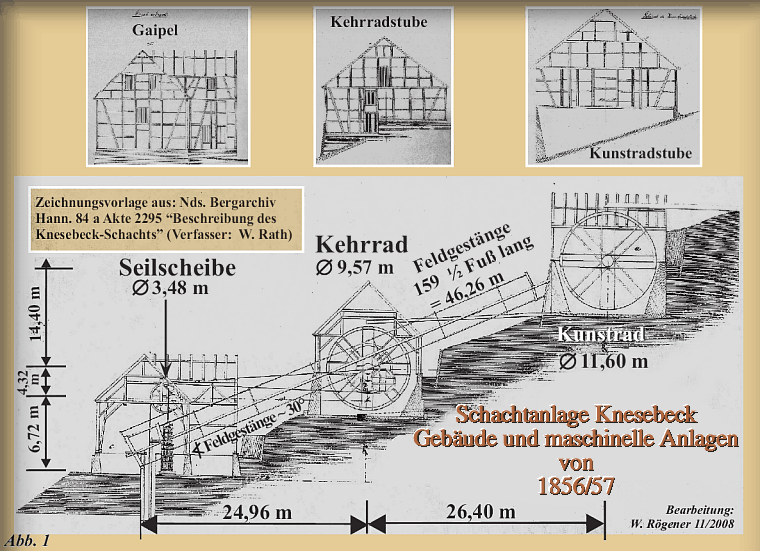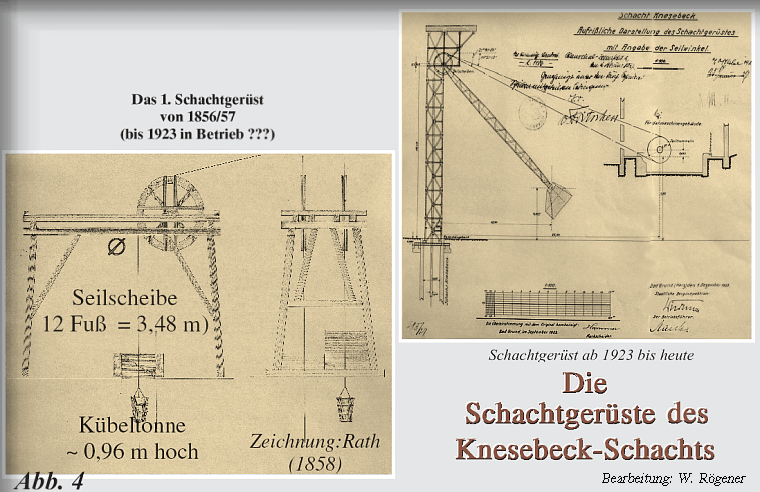|
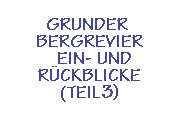
|
 ((W.
R. Nov. 2009) Von
den im Teil 2 vorgestellten vier Tagesschächten des
Erzbergwerks Grund ist der KnesebeckSchacht nicht
nur der älteste Schacht (Teufbeginn 1855), sondern auch der Schacht,
der wegen seiner direkten Lage im ((W.
R. Nov. 2009) Von
den im Teil 2 vorgestellten vier Tagesschächten des
Erzbergwerks Grund ist der KnesebeckSchacht nicht
nur der älteste Schacht (Teufbeginn 1855), sondern auch der Schacht,
der wegen seiner direkten Lage im |
|
 Abbildung
5: Im Dreiklang Diffusor, Schachtgerüst und
Teilsansicht
des Hydrokompressorenturms um 1980.
Abbildung
5: Im Dreiklang Diffusor, Schachtgerüst und
Teilsansicht
des Hydrokompressorenturms um 1980. |
Ortsgebiet
der Bergstadt Bad Grund (Harz), eine sehr wechselvolle Teufgeschichte vorzeigen
kann.
In
diesem Teil der Ein- und Rückblicke soll auf diesen Schacht und die
gleichzeitige Anlegung weiterer Anlagen eingegangen werden, die unter dem
Sammelbegriff Schachtanlage Knesebeck-Schacht zu sehen sind. |
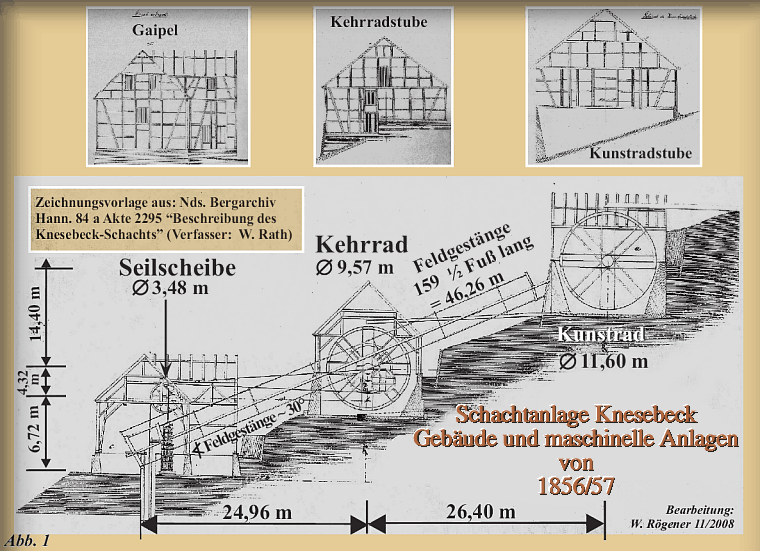
|
|
 Rath
hat, so weisen es die Zeichnungen aus, die Anlagen und Gebäude selbst
aufgenommen und daraus die Zeichnungen entwickelt. Bei heutiger Betrachtung
kann nur schwer nachvollzogen werden, dass in so kurzer Zeit solche baulichen
Maßnahmen geleistet werden konnten, wie die Zeichnung dieses
zeigt. In der genannten Zeit war die Schachtanlage Knesebeck-Schacht
eine Großbaustelle. Insgesamt waren hier nachweislich gut 100 Arbeiter
im Einsatz. Für die zu bewältigenden Arbeiten musste die Stammbelegschaft,
aus den umliegenden Gruben, durch Hilfskräfte aus dem Harzvorland
ergänzt werden. Rath
hat, so weisen es die Zeichnungen aus, die Anlagen und Gebäude selbst
aufgenommen und daraus die Zeichnungen entwickelt. Bei heutiger Betrachtung
kann nur schwer nachvollzogen werden, dass in so kurzer Zeit solche baulichen
Maßnahmen geleistet werden konnten, wie die Zeichnung dieses
zeigt. In der genannten Zeit war die Schachtanlage Knesebeck-Schacht
eine Großbaustelle. Insgesamt waren hier nachweislich gut 100 Arbeiter
im Einsatz. Für die zu bewältigenden Arbeiten musste die Stammbelegschaft,
aus den umliegenden Gruben, durch Hilfskräfte aus dem Harzvorland
ergänzt werden.
 Bevor
auf die einzelnen Abbildungen näher eingegangen wird, noch einige
Angaben zur Person Rath. Rath war zu dieser Zeit Bergschüler (Bergbaubeflissener,
Bergbaustudent aus heutiger Sicht), der 1834 geboren wurde. Sein Vater
war Bergchirurgus, so nannte man damals Bergsanitäter. Sein Abgangszeugnis
vom Gymnasium, welches vorliegt, ist auf den 18.09.1855 datiert. Das Abgangszeugnis
seiner Ausbildung weist den 4. August 1859 aus. Außer seiner Beschreibung
vom Knesebeck-Schacht ist von ihm auch eine sehr gute Karte vom Iberg vorhanden. Bevor
auf die einzelnen Abbildungen näher eingegangen wird, noch einige
Angaben zur Person Rath. Rath war zu dieser Zeit Bergschüler (Bergbaubeflissener,
Bergbaustudent aus heutiger Sicht), der 1834 geboren wurde. Sein Vater
war Bergchirurgus, so nannte man damals Bergsanitäter. Sein Abgangszeugnis
vom Gymnasium, welches vorliegt, ist auf den 18.09.1855 datiert. Das Abgangszeugnis
seiner Ausbildung weist den 4. August 1859 aus. Außer seiner Beschreibung
vom Knesebeck-Schacht ist von ihm auch eine sehr gute Karte vom Iberg vorhanden. |
|
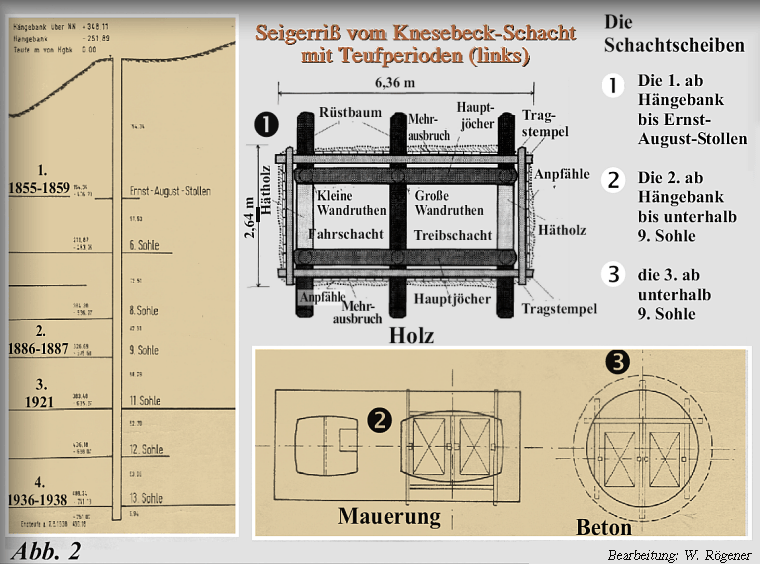  |
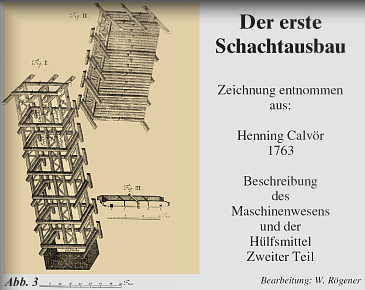
 Zur
Abbildung 1: Zur
Abbildung 1:
Die
Abbildung zeigt deutlich, welche Kraftmaschinen zum Abteufen eines Schachtes
vor gut 150 Jahren noch notwendig waren. Es waren zwei Wasserkraftmaschinen,
welche die Bezeichnung Kunst- beziehungsweise Kehrrad führen. Aufgabe
des Kunstrades war es, über ein Feldgestänge Kolbenpumpen in
Tätigkeit zu setzen.
Das
Kehrrad war ein Teil der zur Schachtförderung notwendigen Maschineneinheit.
Die vom Kehrrad erzeugte Kraft durch Wasser wurde direkt auf eine Getriebewelle
übertragen, auf der ebenfalls zwei zylindrische Seiltrommeln angebracht
waren. Das Ganze war schon eine Fördermaschineneinheit, wie sie heute
noch zu sehen ist. Jedoch mit dem Unterschied, dass anstelle des Kehrrads
ein elektrischer Motor getreten ist. Das die damaligen Wasserkunstanlagen
des Knesebeck-Schachts schon überbaut waren, wie Rath sie in seinen
Zeichnungen dargestellt hat, muss als Besonderheit zu sehen sein.
Zur
Abbildung 2:
Die
Abbildung ist zweigeteilt und zeigt linksseitig im Seigerriß den
gesamten Schacht mit den einzelnen Sohlen und die vier Teufperioden.
Im
Jahr1938 erreichte der Schacht die Endteufe von 499,18 m.
Rechtsseitig
der Abbildung werden die Schachtscheiben (Schachtquerschnitte) dargestellt.
Außergewöhnlich für den Knesebeck-Schacht ist, dass dieser
drei unterschiedliche Schachtscheiben hat. Begonnen wurde 1855 mit einem |
|
rechteckigen
Querschnitt mit Holzausbau!!! Später wurde der ovale Querschnitt gewählt
und der Holzausbau wurde durch Ziegelmauerung ersetzt. Ab der 9. Sohle
wurde der kreisrunde Querschnitt gewählt und als Schachtausbau wurde
Beton eingebracht.
 Zur
Abbildung 3: Zur
Abbildung 3:
Zu
der Zeit als mit dem Abteufen des Knesebeck-Schachts begonnen wurde, war
Holz als Schachtausbau noch geläufig. Der bekannte Berghistoriker
Henning Calvör hat in seinem 1763 erschienenen Buch, in einer Zeichnung,
den Schachtausbau mit Holz dargestellt, wie dieser im Knesebeck-Schacht
eingebaut wurde.
Es
ist fast anzunehmen, dass der Knesebeck-Schacht einer der letzten Schächte
des Oberharzer Reviers war, der noch in Holz ausgebaut wurde, denn etwas
jüngere Schächte wurden schon mit Mauerung oder Betonausbau versehen.
Für
den ersten Bauabschnitts des Schachtes, bis zum Niveau des Ernst-August-Stollens,
wurden auf rund 150 m 150 Festmeter Holz verbaut.
 Zur
Abbildung 4: Zur
Abbildung 4:
Hier
werden die Schachtgerüste gezeigt. Wahrscheinlich hat der Schacht
nur zwei Schachtgerüste gehabt und es ist anzunehmen, dass das erste
Gerüst bis 1923 gestanden hat, denn dem Verfasser ist kein anderes
Gerüst bekannt. Das in der Abbildung gezeigte Schachtgerüst ist
von Rath gezeichnet worden, folglich von vor 1860.
Das
zweite Schachtgerüst wurde 1923 von der Nordhäuser Maschinenfabrik
Schmidt, Kranz & Co. errichtet. Dieses Schachtgerüst ist auch
das heutige.
In
einer handschriftlich vorliegenden Bestellung der „Staatlichen Berginspektion
Bad Grund (Harz)“, an die Schmidt, Kranz & Co., vom 03. Februar 1923,
ist die Bestellung untergliedert in:
1.
Elektrisch angetriebener Förderhaspel (Fördermaschine)
2.
Zwei Förderkörbe einschließlich Zwischengeschirr.
3.
Zwei Seilscheiben, Durchmesser 2000 mm. 4. Ein Fördergerüst.
Zur
Fahrkunst:
Im
Mai 1873 wurde im Knesebeck-Schacht eine Fahrkunst mit 214 m Länge
installiert. Es war dieses die jüngste Anlage im Grunder Revier. In
einer Fahrzeit von rund 28 Minuten konnte man aus einer Tiefe von 200 m
mühelos nach über Tage befördert werden. Die Fahrkunst konnte
nur von vier Personen gleichzeitig benutzt werden. |
 |
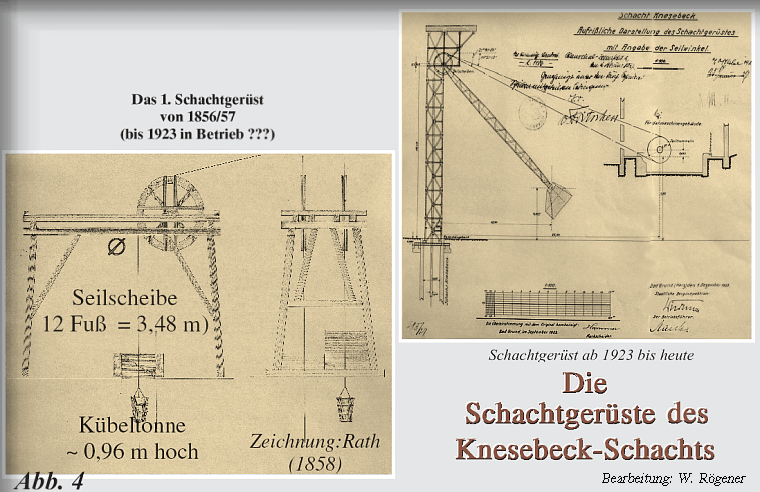 |