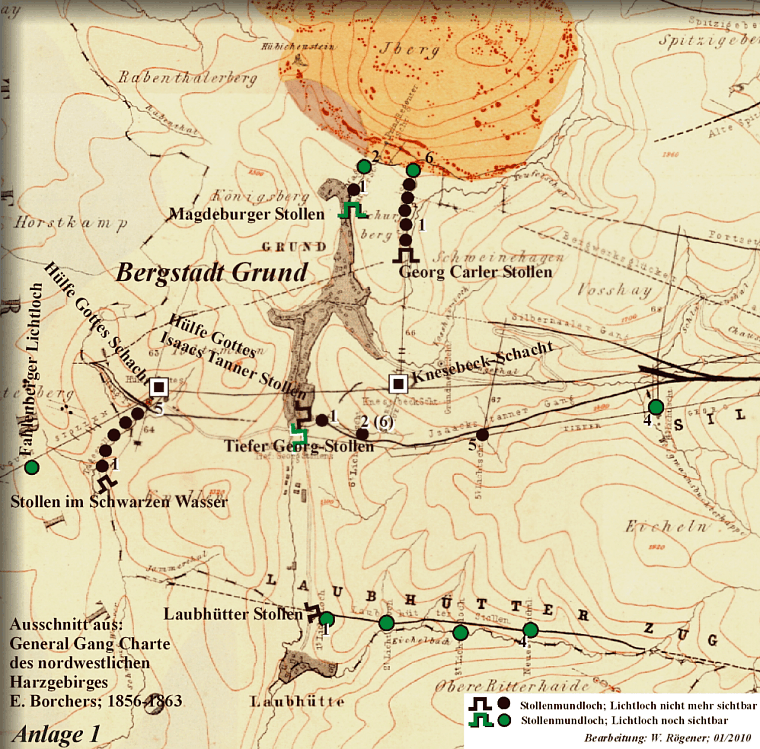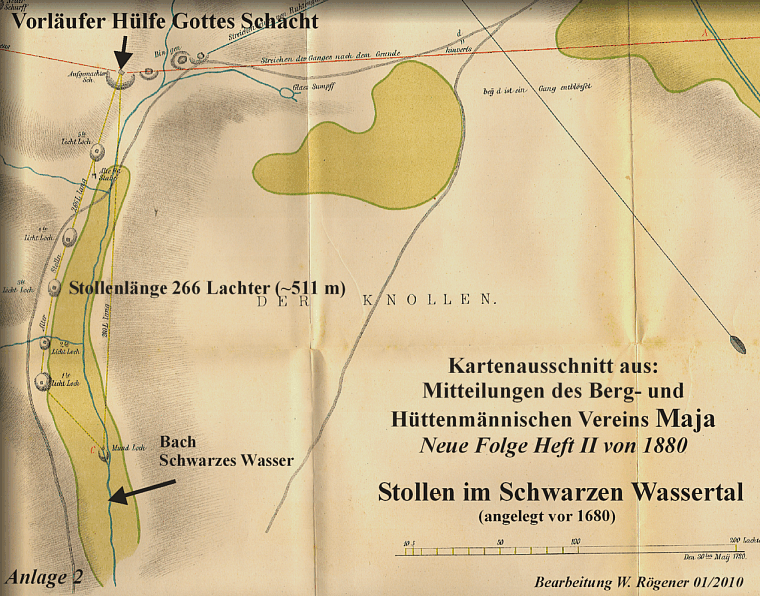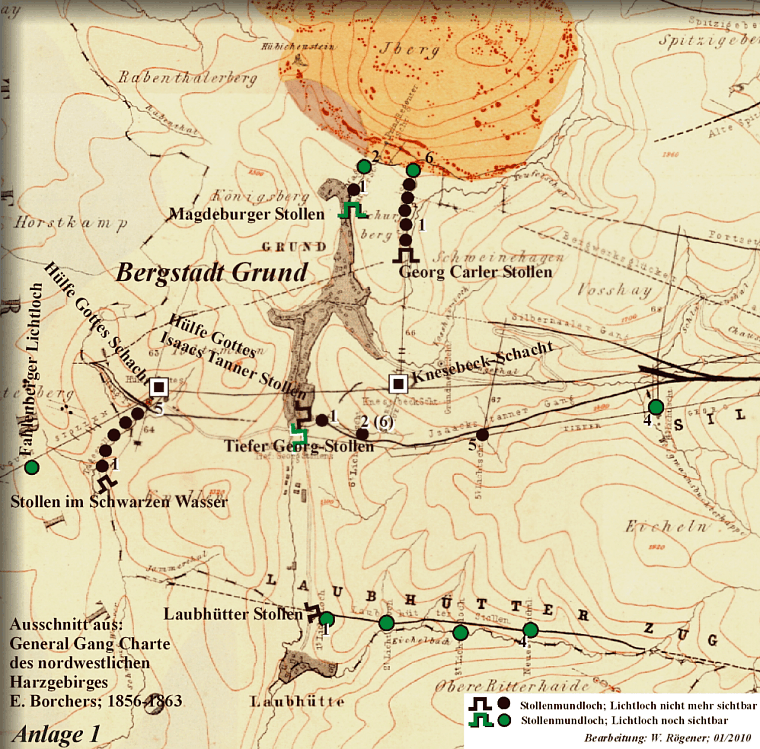
Da
von den 23 einstmals vorhandenen Lichtlöchern nur noch 10 (einschließlich
der Schächte mit Lichtlochfunktion) sichtbar sind, wurde eine farbliche
Differenzierung vorgenommen. So werden die unsichtbaren Lichtlöcher
schwarz dargestellt und die sichtbaren in grün. Gleiches trifft auch
für die ausgewiesenen Stollenmundlöcher zu.
Aus
den Abständen von Lichtloch zu Lichtloch kann eine zeitliche Zuordnung
zur Auffahrung des Stollens abgeleitet werden. So ist zum Beispiel bei
dem Georg Carler Stollen zwischen den Lichtlöchern nur ein geringer
Abstand zu erkennen. Im Gegensatz dazu weist der Stollen im Schwarzen Wasser
schon größere Abstände auf, das bedeutet, dass der Stollen
im Schwarzen Wasser nach dem Georg Carler Stollen aufgefahren wurde. Es
ist dieses eine Feststellung, die sich bei den anderen Stollen des Grunder
Reviers weiter verfolgen lässt. Hierzu die bekannten Auffahrungszeiten:
Magdeburger Stollen ab 1528, Georg Carler Stollen nach 1550, Stollen im
Schwarzen Wasser vor 1680, Laubhütter Stollen ab 1680, Hülfe
Gottes Isaacs Tanner Stollen unklar der Auffahrungsbeginn, jedoch vor Auffahrungsbeginn
des Tiefen Georg-Stollens, der Tiefe Georg-Stollen ab 1777 und der Ernst-August-Stollen
ab 1851. Die immer größeren Abstände zwischen den Lichtlöchern,
im Laufe der Jahrhunderte, sind in der Verbesserung der technischen Voraussetzungen
zu sehen. Die Wetterführung (Luftversorgung) ist mit ziemlicher Sicherheit
der wesentliche Grund dieser Veränderungen.
Da
vielfach in Veröffentlichungen auch von Lichtschächten gesprochen
wird, so bleibt festzuhalten, dass zwischen beiden Begriffen kein Unterschied
besteht. Jeder kann die Bezeichnung wählen, die er für richtig
hält. Unklar ist auch die Definitionsauslegung zu der Bezeichnung
Lichtloch. Hierüber sind schon viele Diskussionen geführt worden,
ein Ergebnis haben diese aber nicht ergeben. |
| Kurzbeschreibungen
der Stollen im Grunder Revier mit den in der Anlage 1 aufgeführten
Lichtlöchern: |
Magdeburger
Stollen:
Als
ältester Stollen des Grunder Reviers gibt der Magdeburger Stollen
auch heute noch auf den rund ersten rund 300 m, mit nur zwei Lichtlöchern,
Rätsel auf. Und dieses besonders deshalb, weil diese Stollenmeter
nicht im devonischen Karstgebiet (Kalkgestein) des Ibergs liegen, sondern
in den Grauwacke- und Tonschieferschichten der geologischen Kulmformation.
Rätselhaft bleibt deshalb, wie hat hier die Bewetterung funktioniert?
Möglicherweise war die sogenannte Diffusionsbewetterung hier noch
wirksam (natürlicher Luftausgleich).
Georg
Carler Stollen:
Obwohl
der genaue Auffahrungsbeginn nicht bekannt ist und etwa nach 1550 liegen
dürfte, hat uns Vice-Oberbergmeisters Spörer 1796 eine Beschreibung
über den Stollen hinterlassen (Bergarchiv CLZ), aus der die Entfernungsangaben
der einzelnen Lichtlöcher entnommen werden konnten. Mit dem 6. Lichtloch
hat der Stollen den Iberger Kalk angefahren und es waren dann keine weiteren
Lichtlöcher bei der Weiterauffahrung nötig, weil durch das durchlöcherte
Karstgebiet (Prinzip Schweizer Käse) veränderte Voraussetzungen
bei der Wetterführung geschaffen wurden.
Stollen
im Schwarzen Wasser:
In
der Literatur als alter Tagesstollen im Schwarzwassertal bezeichnet, hatte
der Stollen 1682 schon eine Länge von 350 Metern. In ca. 25 m Teufe
war der Stollen mit einem Tagesschacht verbunden, der wie aus der Anlage
2 zu entnehmen ist, als Vorläuferschacht des späteren Hülfe
Gotteser Schachts anzusehen ist. Schacht und Stollen haben drei Betriebsphasen
durchgestanden und zwar die Phase 1 vor 1680, die 2. nach 1740 und die
3. nach 1831 (Beginn der ununterbrochenen Betriebszeit der Grube Hilfe
Gottes bis 1992).
Der
Stollen war hauptsächlich Wasserlösungsstollen und war mit der
Inbetriebnahme des Ernst-August-Stollens (1864) nicht mehr erforderlich.
Der Stollen hatte eine Gesamtlänge von um die 500 Meter und 5 Lichtlöcher.
Laubhütter
Stollen:
Der
Laubhütter Stollen wurde 1688 begonnen und stand bis 1718 in Auffahrung
und hat in dieser Zeit eine Gesamtlänge von ca. 1700 m erreicht.
Vier
Lichtlöcher wurden angelegt, von denen ein bereits vor 1688 vorhandener
Schacht (Abraham) tiefer geteuft wurde und dann die Bezeichnung 3. Lichtloch
erhalten hat. Bis auf das 3. Lichtloch sind heute die Lagepunkte der anderen
drei Lichtlöcher noch sehr gut erkennbar.
Hülfe
Gottes Isaacs Tanner Stollen:
Um
1750 wurde der Hülfe Gottes Isaacs Tanner Stollen angesetzt, um den
Isaacs Tanner Gang (heutiger Eichelberger Gang) zu untersuchen. Der Stollen
besaß eine Gesamtlänge von ca. 800 m (Stollenende in kurzer
Entfernung vom 5. Lichtloch des Tiefen Georg-Stollens) und besaß
2 Lichtlöcher, von denen das 2. in die Auffahrung des Tiefen Georg-Stollens
einbezogen wurde und die Bezeichnung 6. Lichtloch erhalten hat. Das Stollenmundloch
liegt nur ca. 40 m vom Mundloch das Tiefen Georg-Stollens entfernt.
Tiefer
Georg-Stollen:
Für
den 1777 begonnenen Tiefen Georg-Stollen wurden im Grunder Revier insgesamt
drei Lichtlöcher angelegt und zwar das 4., 5., und 6., von denen aus
der Stollen in westliche und östliche Richtung aufgefahren wurde.
Sichtbar ist heute nur noch das durch eine Betonplatte abgedeckelte 4.
Lichtloch im eingezäunten Bereich der Schachtanlage Wiemannsbucht.
Ernst-August-Stollen:
Das
markanteste Lichtloch ist das in der Gittelder Feldmarkt am Fahlenberg
gelegene Fahlenberger Lichtloch, das ca. 800 m vom Mundloch entfernt, in
einer dicht zugewachsenen Buschgruppe liegt. Durch das Lichtloch wurden
im Gegensatz zu allen anderen Lichtlöchern des Grunder Reviers jüngere
geologische Schichtfolgen durchörtert, bevor das typische Gestein
des Oberharzes, die Grauwacke, angefahren wurde. Als besondere Gesteinsschicht
wurde auch in geringer Mächtigkeit das Mansfelder Kupferschiefer Flöz
überfahren. Als weitere Ansatzpunkte für die Stollenauffahrung
sind noch der das 4. Lichtloch des Tiefen Georg-Stollens, der Knesebeck-
und Hülfe Gottes Schacht zu nennen. |
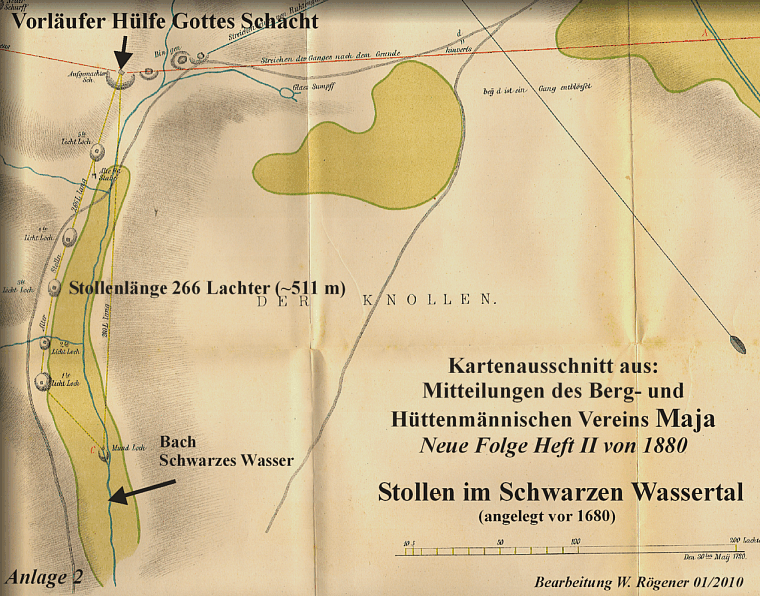 |