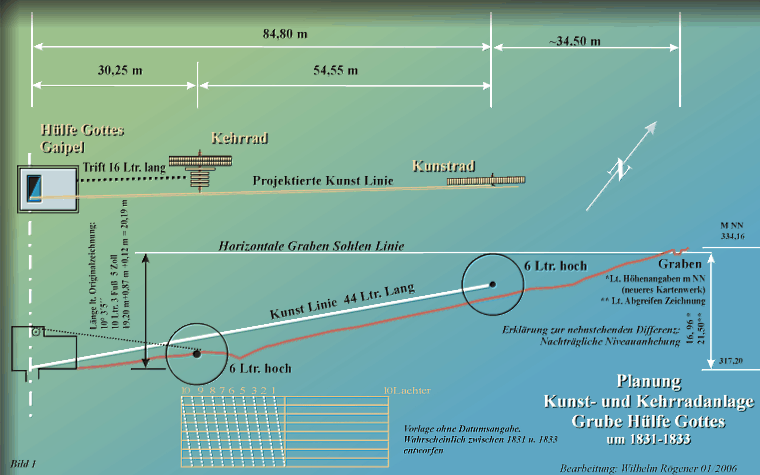|
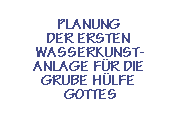
|
 (W.
R. März 2011) Beginnend
mit dem Jahr 1831 wurde in der ältesten Oberharzer Bergstadt Grund
bis 1992, mit der Grube „Hülfe
Gottes“, eine Bergbauperiode eingeleitet, die auf
dem Gebiet der Wasserwirtschaft auch heute noch besondere Aufmerksamkeit
verdient. (W.
R. März 2011) Beginnend
mit dem Jahr 1831 wurde in der ältesten Oberharzer Bergstadt Grund
bis 1992, mit der Grube „Hülfe
Gottes“, eine Bergbauperiode eingeleitet, die auf
dem Gebiet der Wasserwirtschaft auch heute noch besondere Aufmerksamkeit
verdient. |
|
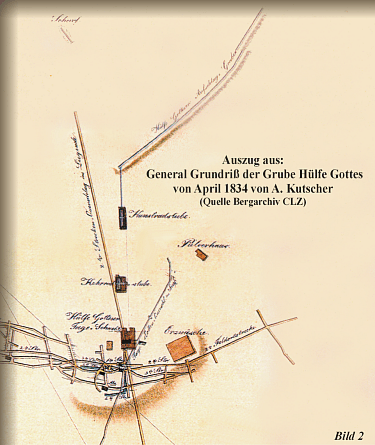 |
 Wie
hoffnungsvoll die damaligen Verantwortlichen die Zukunft dieser Grube damals
gesehen haben, läßt sich am besten dadurch erklären, dass
fast zeitgleich mit der Aufnahme der Bergbautätigkeit am Todtemannsberg,
schon eine Planungsvorlage für Wasserkunstanlagen vorgelegt
wurde (siehe Bild 1). Wie
hoffnungsvoll die damaligen Verantwortlichen die Zukunft dieser Grube damals
gesehen haben, läßt sich am besten dadurch erklären, dass
fast zeitgleich mit der Aufnahme der Bergbautätigkeit am Todtemannsberg,
schon eine Planungsvorlage für Wasserkunstanlagen vorgelegt
wurde (siehe Bild 1).
 Als
Besonderheit bei der Planungsvorlage muss gesehen werden, dass nicht nur
das Problem der Wasserlösung gesehen wurde, sondern auch das der Förderung
des Erzes von untertage zur Tagesoberfläche. Als
Besonderheit bei der Planungsvorlage muss gesehen werden, dass nicht nur
das Problem der Wasserlösung gesehen wurde, sondern auch das der Förderung
des Erzes von untertage zur Tagesoberfläche. |
|
 Das
heißt, dass gleichzeitig eine Kunstrad- und Kehrradanlage gebaut
werden sollten (Anm.: Kunstradanlage = Pumpanlage, Kehrradanlage = Anlage
zur Erzförderung u. a.). Das
heißt, dass gleichzeitig eine Kunstrad- und Kehrradanlage gebaut
werden sollten (Anm.: Kunstradanlage = Pumpanlage, Kehrradanlage = Anlage
zur Erzförderung u. a.).
Nicht
unbekannt war den Planern, dass für das Betreiben der Wasserkunstanlagen
nur Wasser als Antriebsenergie genutzt werden konnte. Und hier war aus
mehrhundertjähriger Vergangenheit bekannt, wie problematisch das natürliche
Wasserangebot im Umfeld der neuen Grube und im direkten Grunder Einzugsgebiet
zu sehen ist. So war aus der Vergangenheit bekannt, dass am Todtemannsberg
schon Wasserkunstanlagen bei früheren bergbaulichen Aktivitäten
gebaut wurden und diese wegen Wassermangels nicht angeschützt (in
Betrieb genommen) werden konnten. |
 Als
weiteres Beispiel für den Wassermangel im Grunder Bergrevier ist auch
die erste und einzige Wasserkunstanlage im Iberger Bergrevier (Schüffelberger
Wasserkunst) zu sehen, für die schon um 1680 aus dem Einzugsgebiet
der Innerste Aufschlagwasser herangeschafft werden mußte und zwar
aus dem Großen Kreuzbachtal. Auch beim Bau des Tiefen
Georg-Stollens wurde für zwei Lichtlöcher, im
Grunder Revier (4. u. 5.), Aufschlagwasser aus dem Einzugsgebiet
der Innerste herangeführt. Zwischen 1777 und 1780 wurde deshalb zunächst
vom Taternplatz (Paßhöhe 517 an der B 242) bis zum Großen
Kreuzbachtal ein Graben angelegt, der nur kurze Zeit später bis zum
Oberen Hahnebalzer Teich verlängert worden ist. Mit der Fertigstellung
des Tiefen Georg-Stollens 1799 konnte der Graben aufgegeben werden. Als
weiteres Beispiel für den Wassermangel im Grunder Bergrevier ist auch
die erste und einzige Wasserkunstanlage im Iberger Bergrevier (Schüffelberger
Wasserkunst) zu sehen, für die schon um 1680 aus dem Einzugsgebiet
der Innerste Aufschlagwasser herangeschafft werden mußte und zwar
aus dem Großen Kreuzbachtal. Auch beim Bau des Tiefen
Georg-Stollens wurde für zwei Lichtlöcher, im
Grunder Revier (4. u. 5.), Aufschlagwasser aus dem Einzugsgebiet
der Innerste herangeführt. Zwischen 1777 und 1780 wurde deshalb zunächst
vom Taternplatz (Paßhöhe 517 an der B 242) bis zum Großen
Kreuzbachtal ein Graben angelegt, der nur kurze Zeit später bis zum
Oberen Hahnebalzer Teich verlängert worden ist. Mit der Fertigstellung
des Tiefen Georg-Stollens 1799 konnte der Graben aufgegeben werden.
 Es
war nur eine kurze Zeit, dass der Graben außer Betrieb war. Denn
1834 wurde er wieder aktiviert, damit den Wasserkunstanlagen der Grube
Hülfe Gottes ausreichend Aufschlagwasser zugeführt werden konnte.
Hierzu mußte ein neuer Graben vom 5. Lichtloch des Tiefen Georg-Stollens
in Richtung auf die Grube Hülfe Gottes zu angelegt werden. Vom 5.
Lichtloch ab wurde der neue Graben auf einen kleinen Bach zugeführt
(bei Schönhofsblick), über den das Wasser talwärts
bis zur Höhe 352 m NN geleitet wurde. Über einen weiteren kurzen
Graben wurde ein Punkt erreicht, der die Planer vor allerhöchste Schwierigkeiten
gestellt hat, denn das Wasser mußte jetzt talüberquerend vom
Eichelberg zum gegenüberliegenden Knollen
(auf 334 m NN) geführt
werden und zwar über eine Rohrleitung. Es
war nur eine kurze Zeit, dass der Graben außer Betrieb war. Denn
1834 wurde er wieder aktiviert, damit den Wasserkunstanlagen der Grube
Hülfe Gottes ausreichend Aufschlagwasser zugeführt werden konnte.
Hierzu mußte ein neuer Graben vom 5. Lichtloch des Tiefen Georg-Stollens
in Richtung auf die Grube Hülfe Gottes zu angelegt werden. Vom 5.
Lichtloch ab wurde der neue Graben auf einen kleinen Bach zugeführt
(bei Schönhofsblick), über den das Wasser talwärts
bis zur Höhe 352 m NN geleitet wurde. Über einen weiteren kurzen
Graben wurde ein Punkt erreicht, der die Planer vor allerhöchste Schwierigkeiten
gestellt hat, denn das Wasser mußte jetzt talüberquerend vom
Eichelberg zum gegenüberliegenden Knollen
(auf 334 m NN) geführt
werden und zwar über eine Rohrleitung.
  Es
war dieses ein Wagnis, weil erstmals eine solche Maßnahme gerade
hier im Grunder Bergrevier umgesetzt werden sollte. Wie bekannt, ist der
Versuch erfolgreich verlaufen. Von der Knollenseite aus konnte das Wasser
dann ohne Schwierigkeiten, über einen weiteren Graben, dem Hülfe
Gotteser Aufschlaggraben, bis zu den Wasserkunstanlagen geführt werden. Es
war dieses ein Wagnis, weil erstmals eine solche Maßnahme gerade
hier im Grunder Bergrevier umgesetzt werden sollte. Wie bekannt, ist der
Versuch erfolgreich verlaufen. Von der Knollenseite aus konnte das Wasser
dann ohne Schwierigkeiten, über einen weiteren Graben, dem Hülfe
Gotteser Aufschlaggraben, bis zu den Wasserkunstanlagen geführt werden.
 Dieses
war die erste Planungsphase für die 1831 in Betrieb genommenen Grube
Hülfe Gottes, die nun ab 1834 mit Aufschlagwasser vom Oberen Hahnebalzer
Teich versorgt werden konnte. Ab 1838 konnte diese Aufschlagwasserversorgung
der ersten Planungsphase bereits wieder beendet werden, denn der vom Oberen
Hahnebalzer Teich bis zum Taternplatz geführte Graben wurde überflüssig,
weil unter Nutzung eines alten vom Innerstetal ausgehenden Bergwerksstollens
(Pelicaner
Flügelort) eine Verbindung zum Grunder Tal in Nähe des 4.
Lichtlochs des Tiefen Georg-Stollens, geschaffen wurde. Diese Stollenverbindung
zwischen dem Innerstetal und dem Grunder Tal hat den Namen Schulte Stollen
erhalten. Dieses
war die erste Planungsphase für die 1831 in Betrieb genommenen Grube
Hülfe Gottes, die nun ab 1834 mit Aufschlagwasser vom Oberen Hahnebalzer
Teich versorgt werden konnte. Ab 1838 konnte diese Aufschlagwasserversorgung
der ersten Planungsphase bereits wieder beendet werden, denn der vom Oberen
Hahnebalzer Teich bis zum Taternplatz geführte Graben wurde überflüssig,
weil unter Nutzung eines alten vom Innerstetal ausgehenden Bergwerksstollens
(Pelicaner
Flügelort) eine Verbindung zum Grunder Tal in Nähe des 4.
Lichtlochs des Tiefen Georg-Stollens, geschaffen wurde. Diese Stollenverbindung
zwischen dem Innerstetal und dem Grunder Tal hat den Namen Schulte Stollen
erhalten.
 Welche
Bedeutung die Aufschlagwasserzuführung für das Grunder Bergrevier
von der Innerste bis zur Grube Hülfe Gottes ab 1838 gehabt hat, zeigt
der Clausthaler „Königliche Maschinenmeister A. Dumreicher in seinem
Buch von 1868 mit dem Titel „Gesamtüberblick über die Wasserwirtschaft
des nordwestlichen Oberharzes“ auf. Zusammen mit den Kunsträdern an
der Grube Hülfe Gottes sind zwölf Kunsträder an dem Aufschlagwasserstrang
angeschlossen (3 Kunsträder, 4 Kehrräder und 5 Wäsche-bzw.
Pochräder), die hintereinander beaufschlagt wurden. Bis in die
heutige Zeit wird dieses System innerhalb der Oberharzer Wasserwirtschaft
unter der Bezeichnung „Grunder
Gefälle“ geführt und war besonders durch das
Wasserregal abgesichert. Leider hat das „Grunder Gefälle“ nach dem
bisherigen Kenntnisstand des Verfassers nicht die Würdigung bei der
Aufnahme in das UNESCO Weltkulturerbe gefunden, die diesem System innerhalb
der Oberharzer Wasserwirtschaft zusteht. Allein schon die „kommunizierende
Rohrleitung“ ist innerhalb der Oberharzer Wasserwirtschaft
eine Besonderheit, die nicht in Vergessenheit geraten darf. Welche
Bedeutung die Aufschlagwasserzuführung für das Grunder Bergrevier
von der Innerste bis zur Grube Hülfe Gottes ab 1838 gehabt hat, zeigt
der Clausthaler „Königliche Maschinenmeister A. Dumreicher in seinem
Buch von 1868 mit dem Titel „Gesamtüberblick über die Wasserwirtschaft
des nordwestlichen Oberharzes“ auf. Zusammen mit den Kunsträdern an
der Grube Hülfe Gottes sind zwölf Kunsträder an dem Aufschlagwasserstrang
angeschlossen (3 Kunsträder, 4 Kehrräder und 5 Wäsche-bzw.
Pochräder), die hintereinander beaufschlagt wurden. Bis in die
heutige Zeit wird dieses System innerhalb der Oberharzer Wasserwirtschaft
unter der Bezeichnung „Grunder
Gefälle“ geführt und war besonders durch das
Wasserregal abgesichert. Leider hat das „Grunder Gefälle“ nach dem
bisherigen Kenntnisstand des Verfassers nicht die Würdigung bei der
Aufnahme in das UNESCO Weltkulturerbe gefunden, die diesem System innerhalb
der Oberharzer Wasserwirtschaft zusteht. Allein schon die „kommunizierende
Rohrleitung“ ist innerhalb der Oberharzer Wasserwirtschaft
eine Besonderheit, die nicht in Vergessenheit geraten darf.
 Welche
Bedeutung und Weitsichtigkeit die Aufschlagwasserversorgung für
die Grube Hülfe Gottes nach 1834 gehabt hat, geht daraus hervor, dass
bis zur endgültigen Schließung der Grube im Jahr 1992 dieses
Versorgungssystem funktioniert hat, denn 11 Kubikmeter pro Minute haben
ausgereicht, um das erforderliche Betriebswasser sicher zu stellen. Welche
Bedeutung und Weitsichtigkeit die Aufschlagwasserversorgung für
die Grube Hülfe Gottes nach 1834 gehabt hat, geht daraus hervor, dass
bis zur endgültigen Schließung der Grube im Jahr 1992 dieses
Versorgungssystem funktioniert hat, denn 11 Kubikmeter pro Minute haben
ausgereicht, um das erforderliche Betriebswasser sicher zu stellen.
 |