 |
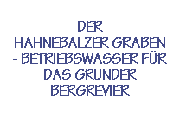
|
 (W.
R., Juni 2011) Im
Zusammenhang mit dem Bau des Tiefen Georg-Stollens
(Bauzeit 1777-1799) wurde wieder, wie bereits vor gut einhundert Jahren,
das Wassereinzugsgebiet der Innerste zur Betriebswasserversorgung
des Grunder Bergreviers heran gezogen. (W.
R., Juni 2011) Im
Zusammenhang mit dem Bau des Tiefen Georg-Stollens
(Bauzeit 1777-1799) wurde wieder, wie bereits vor gut einhundert Jahren,
das Wassereinzugsgebiet der Innerste zur Betriebswasserversorgung
des Grunder Bergreviers heran gezogen. |
|
|
 Um
1680 war es die am Südosthang des Ibergs gelegene Grube Alter Schüffelberg,
die für die Wasserkunstanlage Aufschlagwasser aus dem Großen
Kreuzbachtal bezogen hat (siehe Allg. Harz-Berg-Kalender 2005, Seite 78-80).
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde auch bei der Anlegung der im Grunder
Bergrevier liegenden Lichtlöcher 4 und 5, des Tiefen Georg-Stollens,
auf das Wassereinzugsgebiet der Innerste zugegriffen, um ausreichend Aufschlagwasser
für die notwendigen Wasserkunstanlagen bereitstellen zu können. Um
1680 war es die am Südosthang des Ibergs gelegene Grube Alter Schüffelberg,
die für die Wasserkunstanlage Aufschlagwasser aus dem Großen
Kreuzbachtal bezogen hat (siehe Allg. Harz-Berg-Kalender 2005, Seite 78-80).
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde auch bei der Anlegung der im Grunder
Bergrevier liegenden Lichtlöcher 4 und 5, des Tiefen Georg-Stollens,
auf das Wassereinzugsgebiet der Innerste zugegriffen, um ausreichend Aufschlagwasser
für die notwendigen Wasserkunstanlagen bereitstellen zu können.
 Fast
gleichzeitig mit dem Ansatz der Lichtlöcher 4 und 5 wurde vom heutigen
Taternplatz aus, 1777 ein Graben bis zum Griesbach (heutiges Paulwasser)
angelegt. In einem „Pro Memoria“ vom 12. August 1780, verfasst vom Oberbergmeister
Georg Andreas Steltzner (Anm. verdienstvolle und mit dem Bau des Tiefen
Georg-Stollens eng verbundene Person), führt dieser an, dass das aus
dem Griesbach über den bisherigen Graben ins Grunder Revier geleitete
Aufschlagwasser nicht ausreicht, um die beiden in Auffahrung befindlichen
Lichtlöcher mit dem notwendigen Betriebswasser versorgen zu können.
Weiter wird von Steltzner hierzu vorgetragen, dass die Lichtlöcher
zu dieser Zeit schon Teufen (Tiefen) von zehn Hubsätzen das 4. und
neun Hubsätze das 5. erreicht haben (1 Hubsatz rd. 10m). Fast
gleichzeitig mit dem Ansatz der Lichtlöcher 4 und 5 wurde vom heutigen
Taternplatz aus, 1777 ein Graben bis zum Griesbach (heutiges Paulwasser)
angelegt. In einem „Pro Memoria“ vom 12. August 1780, verfasst vom Oberbergmeister
Georg Andreas Steltzner (Anm. verdienstvolle und mit dem Bau des Tiefen
Georg-Stollens eng verbundene Person), führt dieser an, dass das aus
dem Griesbach über den bisherigen Graben ins Grunder Revier geleitete
Aufschlagwasser nicht ausreicht, um die beiden in Auffahrung befindlichen
Lichtlöcher mit dem notwendigen Betriebswasser versorgen zu können.
Weiter wird von Steltzner hierzu vorgetragen, dass die Lichtlöcher
zu dieser Zeit schon Teufen (Tiefen) von zehn Hubsätzen das 4. und
neun Hubsätze das 5. erreicht haben (1 Hubsatz rd. 10m). |
|
 |
 Von
Steltzner wird weiter in Vorschlag gebracht, dass im Paulswasser entweder
ein Teich angelegt wird oder man verlängert den schon bestehenden
Graben bis zum Oberen Hahnebalzer Teich. Als beste und günstigste
Variante kam die Grabenverlängerung zur Durchführung. Diese Grabenanlegung
wurde schnellstens in Angriff genommen und sollte, so die Planung, noch
bis zum Winterbeginn 1780 abgeschlossen sein. Um dieses zu ermöglichen,
wurden aus vier verschiedenen Revieren, um Clausthal herum, Grabenarbeiter
abgestellt. Von
Steltzner wird weiter in Vorschlag gebracht, dass im Paulswasser entweder
ein Teich angelegt wird oder man verlängert den schon bestehenden
Graben bis zum Oberen Hahnebalzer Teich. Als beste und günstigste
Variante kam die Grabenverlängerung zur Durchführung. Diese Grabenanlegung
wurde schnellstens in Angriff genommen und sollte, so die Planung, noch
bis zum Winterbeginn 1780 abgeschlossen sein. Um dieses zu ermöglichen,
wurden aus vier verschiedenen Revieren, um Clausthal herum, Grabenarbeiter
abgestellt.
 Die
Planungsvorgaben für die Grabenverlängerung wurden voll erfüllt
und in einem Extract des Clausthalischen Berg Amts Protocolli de Nr. 10
Qu. Luciae 1780 (Herbstquartal) wird aufgeführt: “Nachrichtlich ist
von dem Oberbergmeister Steltzner gemeldet, dass der Neue Graben, welcher
behufs des Tiefen Georg Stollens nach dem Hahnebalzer Teich gemacht ist,
soweit fertig sey...” Die
Planungsvorgaben für die Grabenverlängerung wurden voll erfüllt
und in einem Extract des Clausthalischen Berg Amts Protocolli de Nr. 10
Qu. Luciae 1780 (Herbstquartal) wird aufgeführt: “Nachrichtlich ist
von dem Oberbergmeister Steltzner gemeldet, dass der Neue Graben, welcher
behufs des Tiefen Georg Stollens nach dem Hahnebalzer Teich gemacht ist,
soweit fertig sey...”
 Mit der Grabenanbindung an den Oberen Hahnebalzer Teich (Bild 1) und die
Möglichkeit Bachwasser aus mehreren oberhalb des Grabens liegenden
Bächen in den Graben mit einzuleiten, wurde das Planungsziel erreicht.
Mit der Grabenanbindung an den Oberen Hahnebalzer Teich (Bild 1) und die
Möglichkeit Bachwasser aus mehreren oberhalb des Grabens liegenden
Bächen in den Graben mit einzuleiten, wurde das Planungsziel erreicht.
 Der Graben vom Fuß des Oberen Hahnebalzerteichs (Höhe +527m
NN) bis zum Taternplatz (Höhe +517m NN), führt den Namen Hahnebalzergraben.
Etwas ausführlicher hat der Markscheider Quensell den Graben in seiner
Zeichnung (Bild 2) benannt und nennt ihn:„Graben aus dem oberen Hahnebalzer
Teiche nach dem Tiefen Georg Stollen 4ten Lichtloch“.
Der Graben vom Fuß des Oberen Hahnebalzerteichs (Höhe +527m
NN) bis zum Taternplatz (Höhe +517m NN), führt den Namen Hahnebalzergraben.
Etwas ausführlicher hat der Markscheider Quensell den Graben in seiner
Zeichnung (Bild 2) benannt und nennt ihn:„Graben aus dem oberen Hahnebalzer
Teiche nach dem Tiefen Georg Stollen 4ten Lichtloch“.
  Der
Graben hat eine Länge von ca. 6200m. Der Höhenunterschied vom
Oberen Hahnebalzer Teich bis zum Taternplatz beträgt 10m. Das bedeutet,
dass der Graben auf 620m Länge ein Gefälle von einem Meter hat
(Bild 4). Der
Graben hat eine Länge von ca. 6200m. Der Höhenunterschied vom
Oberen Hahnebalzer Teich bis zum Taternplatz beträgt 10m. Das bedeutet,
dass der Graben auf 620m Länge ein Gefälle von einem Meter hat
(Bild 4).
 Wie lange der Graben im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefen Georg-Stollens
in Betrieb war, kann nicht genau angegeben werden, denn nachdem die Stollenauffahrungen
von den beiden Lichtlöchern aus beendet waren, wurden von den Lichtlöchern
aus noch Untersuchungsstollen, gegen Norden in Richtung Voßhai vorgenommen.
Nach Abschluss dieser Untersuchungsarbeiten wurde der Graben außer
Betrieb genommen.
Wie lange der Graben im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefen Georg-Stollens
in Betrieb war, kann nicht genau angegeben werden, denn nachdem die Stollenauffahrungen
von den beiden Lichtlöchern aus beendet waren, wurden von den Lichtlöchern
aus noch Untersuchungsstollen, gegen Norden in Richtung Voßhai vorgenommen.
Nach Abschluss dieser Untersuchungsarbeiten wurde der Graben außer
Betrieb genommen.
 Mit
der Aufnahme des Bergbaus am Todtemannsberg mit der Grube Hülfe Gottes,
im Jahre 1831, war den Verantwortlichen aus der Vergangenheit bekannt,
dass für das Vordringen in die Tiefe unbedingt Wasserkunstanlagen
für die Erzförderung (Kehrradanlage) und zur Wasserhebung (Kunstradanlage)
notwendig sind. Auch war bekannt, dass im Grunder Bergrevier das vorhandene
Wassereinzugsgebiet keine hinreichende Aufschlagwasserversorgung erwarten
lässt. Deshalb musste wieder das Einzugsgebiet der Innerste in Anspruch
genommen werden, eine Maßnahme übrigens, die bis zur Stillegung
des Grunder Bergbaus im Jahre 1992 erforderlich war. In diesem Fall wurde
der Hahnebalzer Graben wieder aktiviert und speiste von 1834 bis 1838 am
Taternplatz wieder Betriebswasser in das Grunder Revier ein. Mit
der Aufnahme des Bergbaus am Todtemannsberg mit der Grube Hülfe Gottes,
im Jahre 1831, war den Verantwortlichen aus der Vergangenheit bekannt,
dass für das Vordringen in die Tiefe unbedingt Wasserkunstanlagen
für die Erzförderung (Kehrradanlage) und zur Wasserhebung (Kunstradanlage)
notwendig sind. Auch war bekannt, dass im Grunder Bergrevier das vorhandene
Wassereinzugsgebiet keine hinreichende Aufschlagwasserversorgung erwarten
lässt. Deshalb musste wieder das Einzugsgebiet der Innerste in Anspruch
genommen werden, eine Maßnahme übrigens, die bis zur Stillegung
des Grunder Bergbaus im Jahre 1992 erforderlich war. In diesem Fall wurde
der Hahnebalzer Graben wieder aktiviert und speiste von 1834 bis 1838 am
Taternplatz wieder Betriebswasser in das Grunder Revier ein.
 Ab
Ende 1838 konnte der Hahnebalzer Graben endgültig abgeworfen werden,
denn von dieser Zeit ab hat der Schulte Stollen diese Aufgabe übernommen,
der in Nähe des ehemaligen Bahnhofs Silbernaal-Grund das Innerstewasser
in den Stollen eingeleitet hat und das oberhalb des 4. Lichtlochs dem Schultestollengraben
übergeben wurde. Ab
Ende 1838 konnte der Hahnebalzer Graben endgültig abgeworfen werden,
denn von dieser Zeit ab hat der Schulte Stollen diese Aufgabe übernommen,
der in Nähe des ehemaligen Bahnhofs Silbernaal-Grund das Innerstewasser
in den Stollen eingeleitet hat und das oberhalb des 4. Lichtlochs dem Schultestollengraben
übergeben wurde.
 Um
überhaupt eine Vorstellung darüber zu haben, welche Wassermenge
aus dem Innerstegebiet in das Grunder Revier eingeleitet wurde, sei hier
die langfristige Betriebszahl aus den Aufschreibungen des Erzbergwerks
Grund genannt, die 11 Kubikmeter pro Minute betragen hat. Um
überhaupt eine Vorstellung darüber zu haben, welche Wassermenge
aus dem Innerstegebiet in das Grunder Revier eingeleitet wurde, sei hier
die langfristige Betriebszahl aus den Aufschreibungen des Erzbergwerks
Grund genannt, die 11 Kubikmeter pro Minute betragen hat.
 Abschließend
noch einmal zurück zum Hahnebalzer Graben und zu der Frage, “was kann
man heute noch von dem Graben erkennen?” Überwiegend sind die Spuren
durch die Kreuzbachstraße verloren gegangen und nur teilweise deuten
Einmuldungen im Gelände noch auf den Graben hin. Abschließend
noch einmal zurück zum Hahnebalzer Graben und zu der Frage, “was kann
man heute noch von dem Graben erkennen?” Überwiegend sind die Spuren
durch die Kreuzbachstraße verloren gegangen und nur teilweise deuten
Einmuldungen im Gelände noch auf den Graben hin. |
|
 |
|