 |
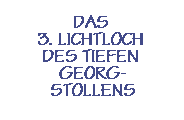
|
 (W.
R., Sept. 2011) Außer dem noch sichtbaren
Mundloch des Tiefen Georg-Stollens im Ortsgebiet der Bergstadt Bad
Grund (Harz), befinden sich im Grunder Bergrevier kaum noch erkennbare
Spuren, die auf diesen Stollen hinweisen. (W.
R., Sept. 2011) Außer dem noch sichtbaren
Mundloch des Tiefen Georg-Stollens im Ortsgebiet der Bergstadt Bad
Grund (Harz), befinden sich im Grunder Bergrevier kaum noch erkennbare
Spuren, die auf diesen Stollen hinweisen. |
|
 |
| Deshalb
soll in diesem Bericht der Blick auf eine Örtlichkeit gerichtet werden,
die zwar außerhalb des Grunder Reviers liegt, die jedoch im Zusammenhang
zum Tiefen Georg-Stollen steht. Es ist dieses das 3. Lichtloch. |
 Vom
Mundloch aus wurden insgesamt sechs Lichtlöcher stollenaufwärts
angelegt, von denen die Lichtlöcher 6, 5 und 4 im Grunder Revier liegen.
Die daran anschließenden Lichtlöcher 3, 2 und 1 liegen im Innerstetal
und zwar vom Taternplatz aus gesehen in Richtung auf die ehemalige Bleihütte
Clausthal zu (genaue Lage der ehemaligen Bleihütte: Einmündung
des Zellbachs in die Innerste). Vom
Mundloch aus wurden insgesamt sechs Lichtlöcher stollenaufwärts
angelegt, von denen die Lichtlöcher 6, 5 und 4 im Grunder Revier liegen.
Die daran anschließenden Lichtlöcher 3, 2 und 1 liegen im Innerstetal
und zwar vom Taternplatz aus gesehen in Richtung auf die ehemalige Bleihütte
Clausthal zu (genaue Lage der ehemaligen Bleihütte: Einmündung
des Zellbachs in die Innerste).
 Bevor
näher auf das 3. Lichtloch eingegangen wird, soll noch aufgezeigt
und erklärt werden, weshalb die Lichtlochnumerierungen beim Tiefen
Georg-Stollen nicht vom Mundloch aus mit der niedrigsten Zahl beginnen
(Zahl
1), wie generell üblich, sondern mit der höchsten
(Zahl
6). Die Lichtlochnumerierungen wurden bei einer Generalbefahrung festgelegt,
die am 1. Juli 1777 stattgefunden hat. Bei dieser Befahrung der Zellerfelder
und Clausthaler Bergoberen, wurden die genauen Lagepunkte der Lichtlöcher
festgelegt. Da der Ausgangspunkt der Befahrung am Fuße der Bergstadt
Clausthal, am Silbersegen war, erhielt das hier etwas unterhalb anzusetzende
Lichtloch die Bezeichnung 1. Lichtloch. Der Ansatzpunkt des 2. Lichtlochs
war in unmittelbarer Nähe des späteren Meding-Schachts (siehe
Bild 1) Bevor
näher auf das 3. Lichtloch eingegangen wird, soll noch aufgezeigt
und erklärt werden, weshalb die Lichtlochnumerierungen beim Tiefen
Georg-Stollen nicht vom Mundloch aus mit der niedrigsten Zahl beginnen
(Zahl
1), wie generell üblich, sondern mit der höchsten
(Zahl
6). Die Lichtlochnumerierungen wurden bei einer Generalbefahrung festgelegt,
die am 1. Juli 1777 stattgefunden hat. Bei dieser Befahrung der Zellerfelder
und Clausthaler Bergoberen, wurden die genauen Lagepunkte der Lichtlöcher
festgelegt. Da der Ausgangspunkt der Befahrung am Fuße der Bergstadt
Clausthal, am Silbersegen war, erhielt das hier etwas unterhalb anzusetzende
Lichtloch die Bezeichnung 1. Lichtloch. Der Ansatzpunkt des 2. Lichtlochs
war in unmittelbarer Nähe des späteren Meding-Schachts (siehe
Bild 1) |
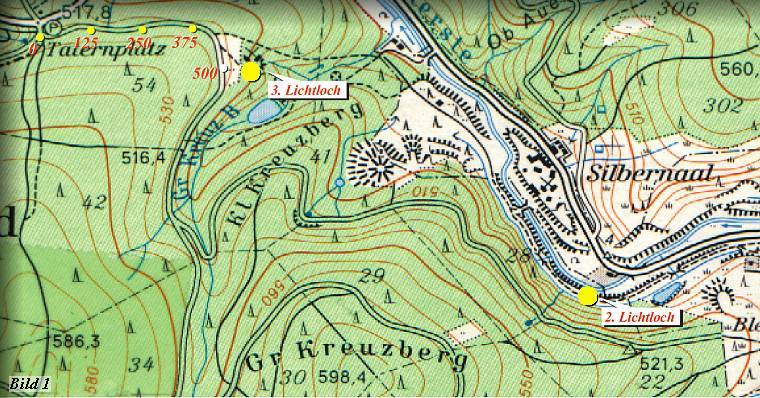 |
 Nun
zum 3. Lichtloch. Wo befindet es sich, wie kann man es erreichen, was ist
heute von dem Lichtloch noch zu sehen und was kann über das Lichtloch
allgemein berichtet werden? Nun
zum 3. Lichtloch. Wo befindet es sich, wie kann man es erreichen, was ist
heute von dem Lichtloch noch zu sehen und was kann über das Lichtloch
allgemein berichtet werden?
 Die
genaue Lage des Lichtlochs zeigt Bild 1 auf. Am besten und leichtesten
ist es vom Taternplatz aus zu erreichen. Von hier aus sind es nur ca. 500m,
um über eine horizontal verlaufende Forststraße, bei Erreichen
einer kleineren Forstwiese, das etwa 70m unter der Forststraße liegende
Lichtloch erblicken zu können. Der obere Trichterkranz des Lichtlochs
ist von hohen Fichten umgrenzt und von der Forststraße gut einsehbar
(Bild
2). Die
genaue Lage des Lichtlochs zeigt Bild 1 auf. Am besten und leichtesten
ist es vom Taternplatz aus zu erreichen. Von hier aus sind es nur ca. 500m,
um über eine horizontal verlaufende Forststraße, bei Erreichen
einer kleineren Forstwiese, das etwa 70m unter der Forststraße liegende
Lichtloch erblicken zu können. Der obere Trichterkranz des Lichtlochs
ist von hohen Fichten umgrenzt und von der Forststraße gut einsehbar
(Bild
2).
 Von
den einstmals sechs Lichtlöchern des Tiefen Georg-Stollens zeigt nur
noch das 3. erkennbare Spuren auf, und diese doch sehr eindrucksvoll. Denn
der Betrachter kann hier einen großen Trichter erkennen, der die
Form eines abgestumpften Kegels in umgekehrter Ausbildung hat. Die Grundfläche
(hier
der Trichterkranz) des Kegels beträgt immerhin gut 20m und die
Kegelhöhe (hier die Tiefe) beträgt gut 8m. Das aus diesen
Angaben zu errechnende Kegelvolumen lässt erkennen, wie groß
ein bestimmter Hohlraumbereich des Lichtlochs war, der nachgebrochen ist
und der sich bekannterweise nur im oberen Lichtlochbereich befunden hat
(Grund:
Verstriegelungen). Von
den einstmals sechs Lichtlöchern des Tiefen Georg-Stollens zeigt nur
noch das 3. erkennbare Spuren auf, und diese doch sehr eindrucksvoll. Denn
der Betrachter kann hier einen großen Trichter erkennen, der die
Form eines abgestumpften Kegels in umgekehrter Ausbildung hat. Die Grundfläche
(hier
der Trichterkranz) des Kegels beträgt immerhin gut 20m und die
Kegelhöhe (hier die Tiefe) beträgt gut 8m. Das aus diesen
Angaben zu errechnende Kegelvolumen lässt erkennen, wie groß
ein bestimmter Hohlraumbereich des Lichtlochs war, der nachgebrochen ist
und der sich bekannterweise nur im oberen Lichtlochbereich befunden hat
(Grund:
Verstriegelungen).
 |
 Der
Trichterhohlraum des 3. Lichtlochs hat sich im Laufe von Jahrzehnten nicht
durch Nachfall verändert, welches darauf schließen lässt,
dass der einstmals vorhandene Hohlraum zur "Ruhe“ gekommen ist. Eher hat
er sich in dieser Zeit durch übertägigen Eintrag verkleinert,
welches auch weiter fortschreiten dürfte. Der
Trichterhohlraum des 3. Lichtlochs hat sich im Laufe von Jahrzehnten nicht
durch Nachfall verändert, welches darauf schließen lässt,
dass der einstmals vorhandene Hohlraum zur "Ruhe“ gekommen ist. Eher hat
er sich in dieser Zeit durch übertägigen Eintrag verkleinert,
welches auch weiter fortschreiten dürfte.
 Wird
der Trichterhohlraum dieses Lichtlochs im Vergleich zu anderen Lichtlöchern
des Oberharzer Bergreviers gesehen, so hält ein guter Kenner der Oberharzer
Wasserwirtschaft diesen Lichtlochtrichter für den größten
in diesem Bergrevier. Wird
der Trichterhohlraum dieses Lichtlochs im Vergleich zu anderen Lichtlöchern
des Oberharzer Bergreviers gesehen, so hält ein guter Kenner der Oberharzer
Wasserwirtschaft diesen Lichtlochtrichter für den größten
in diesem Bergrevier.
 Im
Grunder Bergrevier ist von drei noch gut erkennbaren Lichtlöchern
des Laubhütter Stollens, der Trichter des 4. Lichtlochs überdurchschnittlich
groß, der sich jedoch auch schon durch Fremdeintrag wesentlich verkleinert
hat. Im
Grunder Bergrevier ist von drei noch gut erkennbaren Lichtlöchern
des Laubhütter Stollens, der Trichter des 4. Lichtlochs überdurchschnittlich
groß, der sich jedoch auch schon durch Fremdeintrag wesentlich verkleinert
hat.
 Über
den Ansatzpunkt des 3. Lichtlochs hat es gründliche Diskussionen gegeben.
Es waren drei Ansatzpunkte in die nähere Auswahl gekommen, die bei
der schon genannten Generalbefahrung am 1. Juli 1777 angesprochen wurden. Über
den Ansatzpunkt des 3. Lichtlochs hat es gründliche Diskussionen gegeben.
Es waren drei Ansatzpunkte in die nähere Auswahl gekommen, die bei
der schon genannten Generalbefahrung am 1. Juli 1777 angesprochen wurden.
  Danach
sollte nach einem Befahrungsbericht ein alter Schacht auf dem sogenannten
"Löwen“ genommen werden, so steht es in dem Bericht, der nach Abschätzung
des abgelagerten Haldenmaterials eine Teufe von 6 bis 10 Lachter gehabt
haben soll (Lage siehe Bild 3
und 4, hier als Löwener Pinge gekennzeichnet).
Weiter war in einem "Conferenzprotokoll” vom 19. Juni 1777 der alte "Haus
Hackelberger Schacht“ (siehe Bild 3)
genannt worden. Da über diesen Schacht keine sachdienlichen Angaben
über mögliche Verbindungen durch Klüfte und Gänge zwischen
dem Haus Hackelberger Schacht und dem Haus Braunschweiger Zug (Anm.: gemeint
ist der Silbernaaler Gang) vorlagen und keine Aussagen über mögliche
nicht erwünschte Wasserzuflüsse zu erkennen waren, wird der Vorschlag
einstimmig "abstrahiert“ (gestoppt). Danach
sollte nach einem Befahrungsbericht ein alter Schacht auf dem sogenannten
"Löwen“ genommen werden, so steht es in dem Bericht, der nach Abschätzung
des abgelagerten Haldenmaterials eine Teufe von 6 bis 10 Lachter gehabt
haben soll (Lage siehe Bild 3
und 4, hier als Löwener Pinge gekennzeichnet).
Weiter war in einem "Conferenzprotokoll” vom 19. Juni 1777 der alte "Haus
Hackelberger Schacht“ (siehe Bild 3)
genannt worden. Da über diesen Schacht keine sachdienlichen Angaben
über mögliche Verbindungen durch Klüfte und Gänge zwischen
dem Haus Hackelberger Schacht und dem Haus Braunschweiger Zug (Anm.: gemeint
ist der Silbernaaler Gang) vorlagen und keine Aussagen über mögliche
nicht erwünschte Wasserzuflüsse zu erkennen waren, wird der Vorschlag
einstimmig "abstrahiert“ (gestoppt).
 Weil
beide Vorschläge nicht angenommen wurden, wird die Gegend zwischen
der Löwener Pinge und dem Haus Hackelberger Schacht genauestens untersucht,
um einen "bequemeren“ Ansatzpunkt ausfindig zu machen. So kommt das Pelikaner
Ort wieder ins Gespräch, weil aus Akten bekannt ist, dass das Ort
bis an den Gang vorgetrieben wurde, auf dem der Löwener Schacht liegt.
Da durch einen Ansatzpunkt unterhalb des Löwener Schachts eine geringere
Teufe (Tiefe) gegenüber dem Löwener Schacht gegeben ist
und eine Verbindung zum Pelikaner Ort möglich ist, wird dieser Ansatzpunkt
favorisiert. Weil
beide Vorschläge nicht angenommen wurden, wird die Gegend zwischen
der Löwener Pinge und dem Haus Hackelberger Schacht genauestens untersucht,
um einen "bequemeren“ Ansatzpunkt ausfindig zu machen. So kommt das Pelikaner
Ort wieder ins Gespräch, weil aus Akten bekannt ist, dass das Ort
bis an den Gang vorgetrieben wurde, auf dem der Löwener Schacht liegt.
Da durch einen Ansatzpunkt unterhalb des Löwener Schachts eine geringere
Teufe (Tiefe) gegenüber dem Löwener Schacht gegeben ist
und eine Verbindung zum Pelikaner Ort möglich ist, wird dieser Ansatzpunkt
favorisiert.
 Wegen
der gravierenden Vorteile des Ansatzpunktes unterhalb der Löwener
Pinge zweifeln die Mitglieder der Befahrungskommission nicht daran, dass
die “höhere Genehmigung“ versagt werden könnte. Wegen
der gravierenden Vorteile des Ansatzpunktes unterhalb der Löwener
Pinge zweifeln die Mitglieder der Befahrungskommission nicht daran, dass
die “höhere Genehmigung“ versagt werden könnte.
 Um
den genauen Ansatzpunkt des Lichtlochs genau festlegen zu können,
ist die Aufwältigung des Pelikaner Orts schnellstens erforderlich.
Es wird deshalb bestimmt, dass das Ort sofort belegt wird und das zur Behebung
des Wettermangels eine Wettermaschine herangeschafft wird. Das Lichtloch
ist übertägig dort anzusetzen, an der eine Verbindung mit dem
Pelikaner Ort gegeben ist. Aus einem Extrakt vom 11. Juli 1777 kann entnommen
werden, das der Ansatzpunkt für das Lichtloch 20 Lachter unterhalb
des Löwener Schachts zu liegen kommt. Um
den genauen Ansatzpunkt des Lichtlochs genau festlegen zu können,
ist die Aufwältigung des Pelikaner Orts schnellstens erforderlich.
Es wird deshalb bestimmt, dass das Ort sofort belegt wird und das zur Behebung
des Wettermangels eine Wettermaschine herangeschafft wird. Das Lichtloch
ist übertägig dort anzusetzen, an der eine Verbindung mit dem
Pelikaner Ort gegeben ist. Aus einem Extrakt vom 11. Juli 1777 kann entnommen
werden, das der Ansatzpunkt für das Lichtloch 20 Lachter unterhalb
des Löwener Schachts zu liegen kommt. |
Quellen:
Bergarchiv CL, Akte 1108-10-1 und Archiv Bergbau Goslar (Bild 2).
Fortsetzung
folgt |
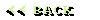 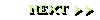
|