 |
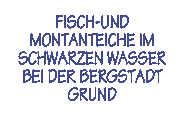
|
 (W.
R., Feb 2012) Nördlich des Harzranddorfes
Windhausen liegt das Tal des „Schwarzen Wassers“, welches im Neubaugebiet
Taubenborn, einem Ortsteil der Bergstadt Bad Grund, endet. (W.
R., Feb 2012) Nördlich des Harzranddorfes
Windhausen liegt das Tal des „Schwarzen Wassers“, welches im Neubaugebiet
Taubenborn, einem Ortsteil der Bergstadt Bad Grund, endet. |
|
|
|
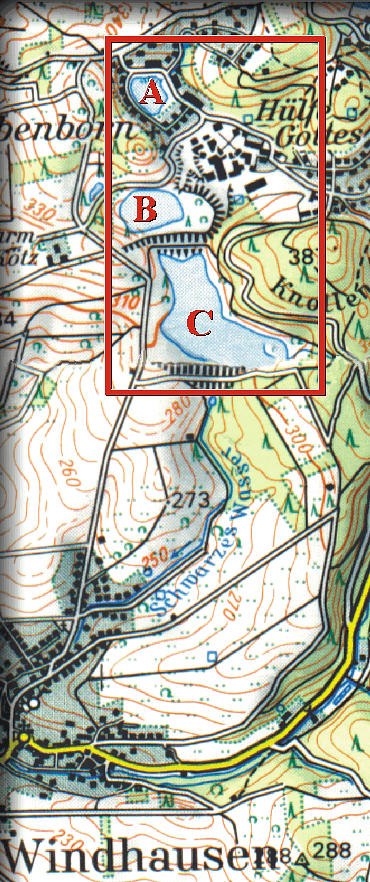 |
Abb.
1: Schwarzes Wasser (Darstellugsgebiet umrahmt) |
 Dieses
Tal hat im Laufe von Jahrhunderten in der unteren Talhälfte seine
ursprüngliche Natürlichkeit annährend behalten, wogegen
im oberen Teil große Veränderungen eingetreten sind. Kartenvergleiche
von einst und jetzt lassen dieses erkennen. Das Lagegebiet der hier vorzustellenden
Fisch- und Montanteiche ist identisch mit dem Gebiet der drei Klärteiche
(A, B, C in Abb.1),
die in den heutigen Kartenwerken ausgewiesen werden. Erste talverändernde
Eingriffe wurden und dieses dürfte sicher sein, mit der Besiedlung
des Raumes im Zusammenhang stehen, indem hier schon sehr früh Fischteiche
angelegt wurden. Weitere folgten mit der Anlegung von zwei Kunstteichen,
die zwischen 1680 bis 1745 notwendig wurden, um Aufschlagwasser für
Kunsträder (Wasserräder) zu speichern, damit im Bedarfsfall
ausreichend Antriebsenergie zur Verfügung stand, damit die Pumpenkünste
in den Schächten zur Wasserhebung betrieben werden konnten. Dieses
Tal hat im Laufe von Jahrhunderten in der unteren Talhälfte seine
ursprüngliche Natürlichkeit annährend behalten, wogegen
im oberen Teil große Veränderungen eingetreten sind. Kartenvergleiche
von einst und jetzt lassen dieses erkennen. Das Lagegebiet der hier vorzustellenden
Fisch- und Montanteiche ist identisch mit dem Gebiet der drei Klärteiche
(A, B, C in Abb.1),
die in den heutigen Kartenwerken ausgewiesen werden. Erste talverändernde
Eingriffe wurden und dieses dürfte sicher sein, mit der Besiedlung
des Raumes im Zusammenhang stehen, indem hier schon sehr früh Fischteiche
angelegt wurden. Weitere folgten mit der Anlegung von zwei Kunstteichen,
die zwischen 1680 bis 1745 notwendig wurden, um Aufschlagwasser für
Kunsträder (Wasserräder) zu speichern, damit im Bedarfsfall
ausreichend Antriebsenergie zur Verfügung stand, damit die Pumpenkünste
in den Schächten zur Wasserhebung betrieben werden konnten.
 Bis
zum Jahre 1831 dürften im oberen Tal des Schwarzen Wassers keine weiteren
großen morphologischen Veränderungen erfolgt sein,
welches aus einer Karte von 1830 (von Wilcke u. Kerl) entnommen
werden kann. Der nachweislich belegbare und bereits im Jahre 1564 begonnene
Bergbau am Todten Mann hat, wegen zeitlich längerer Unterbrechungsphasen,
keine Veränderungen verursacht. Bis
zum Jahre 1831 dürften im oberen Tal des Schwarzen Wassers keine weiteren
großen morphologischen Veränderungen erfolgt sein,
welches aus einer Karte von 1830 (von Wilcke u. Kerl) entnommen
werden kann. Der nachweislich belegbare und bereits im Jahre 1564 begonnene
Bergbau am Todten Mann hat, wegen zeitlich längerer Unterbrechungsphasen,
keine Veränderungen verursacht.
Die
Fischteiche
 Erste
Hinweise auf Teiche im Schwarzen Wasser hat uns der Bergchronist Hardanus
Hake hinterlassen. Hake schreibt im zweiten Kapitel seiner Bergchronik
über die Geschichte des Bergbaus und der Bergstädte, auf dem
ehemals braunschweigischen Oberharz von ca. 1500 bis 1583 und berichtet
darin, dass “der erste Pfarrer in Grund, mit drey fisch Teiche im Schwartzenwaßer,
drey Acker wißken im Langen thall von Frau Elisabeth belehnet wurde“.
Dieses war im Jahr 1505. Erster Pfarrer in Grund war Ern Rodtger Pengaw,
der dieses Amt von 1505 bis 1519 ausgeübt hat. Erste
Hinweise auf Teiche im Schwarzen Wasser hat uns der Bergchronist Hardanus
Hake hinterlassen. Hake schreibt im zweiten Kapitel seiner Bergchronik
über die Geschichte des Bergbaus und der Bergstädte, auf dem
ehemals braunschweigischen Oberharz von ca. 1500 bis 1583 und berichtet
darin, dass “der erste Pfarrer in Grund, mit drey fisch Teiche im Schwartzenwaßer,
drey Acker wißken im Langen thall von Frau Elisabeth belehnet wurde“.
Dieses war im Jahr 1505. Erster Pfarrer in Grund war Ern Rodtger Pengaw,
der dieses Amt von 1505 bis 1519 ausgeübt hat.
 Wann
die von Hake genannten Fischteiche angelegt wurden und ob zur damaligen
Zeit schon mehr als drei vorhanden waren, lässt sich nur vermuten,
denn nach einem Riss von 1796 (Quelle Bergarchiv CLZ), waren im
Schwarzen Wasser insgesamt sieben Teiche vorhanden. Mit großer Wahrscheinlichkeit
dürften die Fischteiche von den Burgherren der ehemaligen Burg Windhausen
angelegt worden sein, die, nach Winfried Kippenberg, 1234 erstmals urkundlich
erwähnt wurden (Quelle: 750 Jahre Windhausen). Damit könnte
die Anlegungszeit um 1300 liegen, sie ist jedoch vor 1500 erfolgt. Wann
die von Hake genannten Fischteiche angelegt wurden und ob zur damaligen
Zeit schon mehr als drei vorhanden waren, lässt sich nur vermuten,
denn nach einem Riss von 1796 (Quelle Bergarchiv CLZ), waren im
Schwarzen Wasser insgesamt sieben Teiche vorhanden. Mit großer Wahrscheinlichkeit
dürften die Fischteiche von den Burgherren der ehemaligen Burg Windhausen
angelegt worden sein, die, nach Winfried Kippenberg, 1234 erstmals urkundlich
erwähnt wurden (Quelle: 750 Jahre Windhausen). Damit könnte
die Anlegungszeit um 1300 liegen, sie ist jedoch vor 1500 erfolgt.
 Die
fast genaue Lage der kaskadenförmig angelegten Fischteiche und der
noch abzuhandelnden Kunstteiche kann in den Abbildungen 2 und 3 nachvollzogen
werden. Grundlage für die Abbildungen sind drei grundrissliche Darstellungen
von 1730, 1796 und 1830 . In den beiden letzteren Rissen ist nur die Lage
der Teichdämme eingezeichnet, eine Darstellung, die für die hier
angefertigten Abbildungen übernommen wurde. Ganz allgemein wird bei
allen Teichen schon von sogenannten „abgegangenen Teichen“ gesprochen und
dieses bereits in dem Riss von 1796. Dieser Hinweis dürfte als Indiz
für die Betriebsdauer der Teiche sein. Eine weitere sehr informative
Aussage erhält der schon genannte 1796-er Riss des Markscheiders J.
Chr. Laenge dadurch, dass schon die 1788 geschaffene neue Grenze zwischen
dem Herzogtum Braunschweig und Kurfürstentum Hannover (ab 1815
Königreich Hannover) versteint ist. Diese Versteinung zeigt auch
der 1830-er Riss des Markscheiders Kerl und C. F. Wilke. Darüber hinaus
sind in diesem Riss in tabellarischen Aufstellungen noch die Entfernungen
der einzelnen Grenzsteine und die Richtungsänderungen durch Winkelangaben,
von Grenzstein zu Grenzstein, angegeben. In der Tabelle, hier Abb. 3, sind in einer
Kurzfassung die Entfernungen von Teichdamm zu Teichdamm aufgeführt,
wobei darauf verwiesen werden muss, dass für die Fischteiche und für
die Kunstteiche unterschiedliche Bezugspunkte gewählt wurden (Punkt
203 für die Fischteiche bzw. 233 für die Kunstteiche). Da
diese Bezugspunkte aus heutigen Kartenwerken entnommen werden können,
kann eine annährende Lage der ehemaligen Teiche gut nachvollzogen
werden. Die
fast genaue Lage der kaskadenförmig angelegten Fischteiche und der
noch abzuhandelnden Kunstteiche kann in den Abbildungen 2 und 3 nachvollzogen
werden. Grundlage für die Abbildungen sind drei grundrissliche Darstellungen
von 1730, 1796 und 1830 . In den beiden letzteren Rissen ist nur die Lage
der Teichdämme eingezeichnet, eine Darstellung, die für die hier
angefertigten Abbildungen übernommen wurde. Ganz allgemein wird bei
allen Teichen schon von sogenannten „abgegangenen Teichen“ gesprochen und
dieses bereits in dem Riss von 1796. Dieser Hinweis dürfte als Indiz
für die Betriebsdauer der Teiche sein. Eine weitere sehr informative
Aussage erhält der schon genannte 1796-er Riss des Markscheiders J.
Chr. Laenge dadurch, dass schon die 1788 geschaffene neue Grenze zwischen
dem Herzogtum Braunschweig und Kurfürstentum Hannover (ab 1815
Königreich Hannover) versteint ist. Diese Versteinung zeigt auch
der 1830-er Riss des Markscheiders Kerl und C. F. Wilke. Darüber hinaus
sind in diesem Riss in tabellarischen Aufstellungen noch die Entfernungen
der einzelnen Grenzsteine und die Richtungsänderungen durch Winkelangaben,
von Grenzstein zu Grenzstein, angegeben. In der Tabelle, hier Abb. 3, sind in einer
Kurzfassung die Entfernungen von Teichdamm zu Teichdamm aufgeführt,
wobei darauf verwiesen werden muss, dass für die Fischteiche und für
die Kunstteiche unterschiedliche Bezugspunkte gewählt wurden (Punkt
203 für die Fischteiche bzw. 233 für die Kunstteiche). Da
diese Bezugspunkte aus heutigen Kartenwerken entnommen werden können,
kann eine annährende Lage der ehemaligen Teiche gut nachvollzogen
werden.
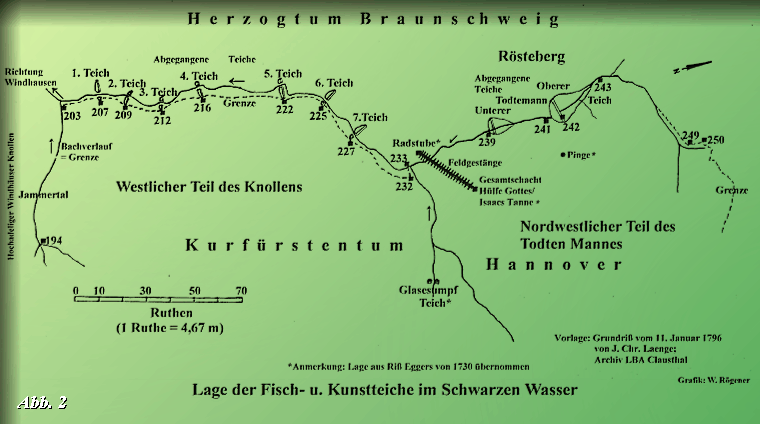
Der Glasesumpfteich
 Als
weiterer mittelalterlicher Teich ist der Glasesumpfteich (siehe
Abb. 2) zu nennen, über dessen Bedeutung
nach wie vor noch Unklarheit besteht. Besonders ist die Anlegungszeit dieses
Teiches schwer zuzuordnen. Erste Hinweise über den Teich gibt, wie
bei den Fischteichen, Hardanus Hake. Weiter berichten Henniges Groscurt
und Johann Zacharias Ernst in ihrer Beschreibung über den gesamten
Communionharz, die zwischen 1675 und 1680 erstellt wurde, dass aus zwei
morastigen Stücken ein gering Wasser kommt, welches den Glasesumpf
verursachet. Weiter wird geschrieben, “einwenig Wasser fließet
herab nach dem Tale, das Glasesumpftal genannt wird.” Die vorgenannten
Autoren haben weiter vermutet, “dass vor ziemlicher Zeit eine Glashütte
allhier gelegen, worauf etliche aufgefundene Stücke hinweisen, die
zur Untersuchungszeit ganz mit Moos bewachsen waren”. In der Abbildung
2 ist der Teichdamm ausgewiesen. Das sogenannte Glasesumpftal, ein sehr
kurzes, vom Schwarzen Wasser östlich abzweigendes Tälchen, wurde
nach 1970 mit sogenannten Schwimmbergen (daumennagelgroße Aufbereitungsrückstände)
aufgefüllt und dann als Parkfläche für die Belegschaft
der Grube Hilfe Gottes genutzt. Als
weiterer mittelalterlicher Teich ist der Glasesumpfteich (siehe
Abb. 2) zu nennen, über dessen Bedeutung
nach wie vor noch Unklarheit besteht. Besonders ist die Anlegungszeit dieses
Teiches schwer zuzuordnen. Erste Hinweise über den Teich gibt, wie
bei den Fischteichen, Hardanus Hake. Weiter berichten Henniges Groscurt
und Johann Zacharias Ernst in ihrer Beschreibung über den gesamten
Communionharz, die zwischen 1675 und 1680 erstellt wurde, dass aus zwei
morastigen Stücken ein gering Wasser kommt, welches den Glasesumpf
verursachet. Weiter wird geschrieben, “einwenig Wasser fließet
herab nach dem Tale, das Glasesumpftal genannt wird.” Die vorgenannten
Autoren haben weiter vermutet, “dass vor ziemlicher Zeit eine Glashütte
allhier gelegen, worauf etliche aufgefundene Stücke hinweisen, die
zur Untersuchungszeit ganz mit Moos bewachsen waren”. In der Abbildung
2 ist der Teichdamm ausgewiesen. Das sogenannte Glasesumpftal, ein sehr
kurzes, vom Schwarzen Wasser östlich abzweigendes Tälchen, wurde
nach 1970 mit sogenannten Schwimmbergen (daumennagelgroße Aufbereitungsrückstände)
aufgefüllt und dann als Parkfläche für die Belegschaft
der Grube Hilfe Gottes genutzt.
Der Untere
Todte Manns Teich
 Die
um 1685 am Fuße des Todten Mannes betriebene Grube Isaacs Tanne (Vorgängergrube
der Grube Hülfe Gottes u. a.) hatte große Schwierigkeiten,
das der Grube zufließende Wasser zu heben. So wird in der Zusammenfassung
des Quartals Trinitatis 1687 berichtet, "dass, wenn eine Kunst nebst dem
Teich vorgerichtet und das Wasser gewältiget werde, man mehr Erz
fördern könne." Die Kunst und der Teich wurden “verfertiget“,
wie dem Grubenbericht des Quartals Crucis 1687 zu entnehmen ist. Allerdings,
so wird weiter berichtet, konnte dieselbe aus Mangel an Wasser nicht angeschützt
werden, eine Erscheinung, die immer wieder während der Betriebszeit
der Wasserkunstanlage aufgetreten ist. Als erstaunlich muss die kurze Bauzeit
von der Wasserkunstanlage und dem Teich angesehen werden. Nur drei Monate
wurden hierzu gebraucht, eine Angabe, die aus den Festschreibungen der
Quartalsberichte von Trinitatis 1687 und Crucis 1687 zu folgern ist. Die
Teichanlage des Unteren Todte Manns Teiches und die Lage der Kunstradstube
sind in dem Riss des Markscheiders Eggers von 1730 ausgewiesen. Diese Ausweisungen
ist in Abbildung 2 übernommen
worden. Vom Kunstrad in der Kunstradstube wurde die erzeugte Energie über
das Feldgestänge (Länge ca. 120m) auf die Pumpenkunst
des damaligen alten Schachtes übertragen (siehe
Abb. 2), der später die Bezeichnung
Gesamtschacht führte. Nach weiteren Quartalsberichten endete die Abbautätigkeit
in der Grube Isaacs Tanne im Quartal Trinitatis 1695 und damit auch die
Betriebszeit der Wasserkunstanlage. Bis 1740 war die Abbautätigkeit
am Fuße des Todten Mannes eingestellt. Die
um 1685 am Fuße des Todten Mannes betriebene Grube Isaacs Tanne (Vorgängergrube
der Grube Hülfe Gottes u. a.) hatte große Schwierigkeiten,
das der Grube zufließende Wasser zu heben. So wird in der Zusammenfassung
des Quartals Trinitatis 1687 berichtet, "dass, wenn eine Kunst nebst dem
Teich vorgerichtet und das Wasser gewältiget werde, man mehr Erz
fördern könne." Die Kunst und der Teich wurden “verfertiget“,
wie dem Grubenbericht des Quartals Crucis 1687 zu entnehmen ist. Allerdings,
so wird weiter berichtet, konnte dieselbe aus Mangel an Wasser nicht angeschützt
werden, eine Erscheinung, die immer wieder während der Betriebszeit
der Wasserkunstanlage aufgetreten ist. Als erstaunlich muss die kurze Bauzeit
von der Wasserkunstanlage und dem Teich angesehen werden. Nur drei Monate
wurden hierzu gebraucht, eine Angabe, die aus den Festschreibungen der
Quartalsberichte von Trinitatis 1687 und Crucis 1687 zu folgern ist. Die
Teichanlage des Unteren Todte Manns Teiches und die Lage der Kunstradstube
sind in dem Riss des Markscheiders Eggers von 1730 ausgewiesen. Diese Ausweisungen
ist in Abbildung 2 übernommen
worden. Vom Kunstrad in der Kunstradstube wurde die erzeugte Energie über
das Feldgestänge (Länge ca. 120m) auf die Pumpenkunst
des damaligen alten Schachtes übertragen (siehe
Abb. 2), der später die Bezeichnung
Gesamtschacht führte. Nach weiteren Quartalsberichten endete die Abbautätigkeit
in der Grube Isaacs Tanne im Quartal Trinitatis 1695 und damit auch die
Betriebszeit der Wasserkunstanlage. Bis 1740 war die Abbautätigkeit
am Fuße des Todten Mannes eingestellt.
|