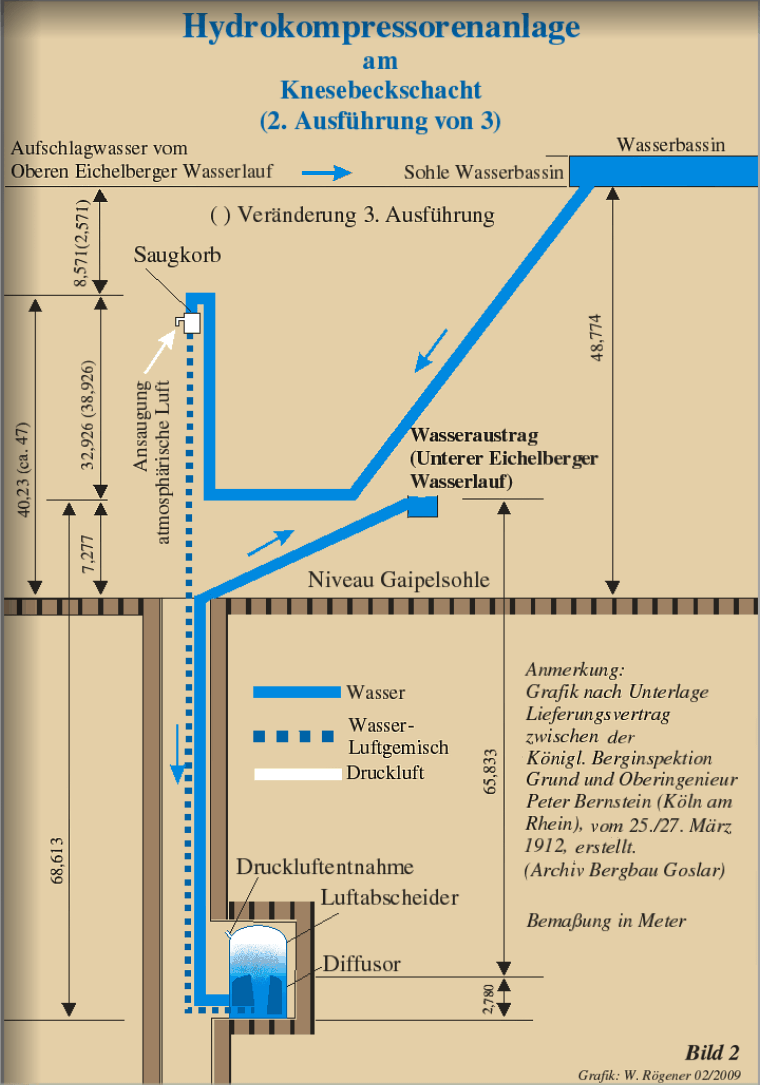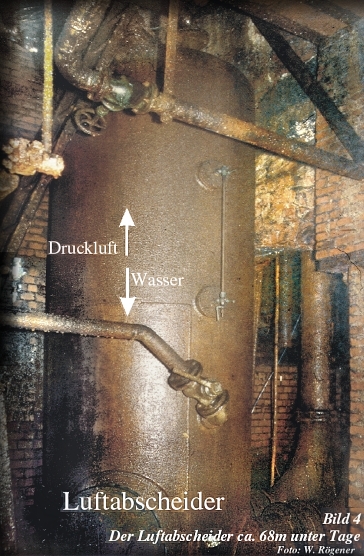|
| Inhaltsverzeichnis:
KLICK! |
Bergbauliches
von Wilhelm Rögener Seite 30 |
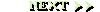 |
|
 |
 |
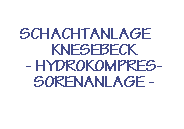
|
 ((W.
R. Juni 2009) Fest
eingebunden in das Ortsbild der Bergstadt Bad Grund (Harz) ist die Schachtanlage
Knesebeck, die schon aus der Entfernung durch zwei Bauwerke, dem Schachtgerüst
und dem Hy- drokompressorenturm, gut erkennbar ist. ((W.
R. Juni 2009) Fest
eingebunden in das Ortsbild der Bergstadt Bad Grund (Harz) ist die Schachtanlage
Knesebeck, die schon aus der Entfernung durch zwei Bauwerke, dem Schachtgerüst
und dem Hy- drokompressorenturm, gut erkennbar ist. |
|
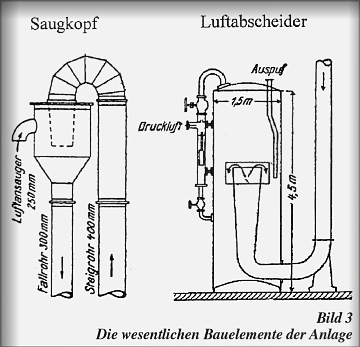 |
| Als
heute denkmalgeschützte Anlagen haben sowohl der Förder- als
auch der Hydrokompressorenturm ein Stück Grunder Bergbau- geschichte
mit geschrieben. |
  Beide
Einrichtungen sind würdige Symbole des bedeutenden Grunder Bergbaureviers
auf Eisenstein und auf silberreiche Blei- und Zinkerze. Im Nachfolgenden
soll über die Aufgabe und Funktion der Hydrokompressorenanlage berichtet
werden. Beide
Einrichtungen sind würdige Symbole des bedeutenden Grunder Bergbaureviers
auf Eisenstein und auf silberreiche Blei- und Zinkerze. Im Nachfolgenden
soll über die Aufgabe und Funktion der Hydrokompressorenanlage berichtet
werden.
 Mit
dem Hydrokompressorenturm der 1992 stillgelegten Schachtanlage Knesebeck
hat das heute auf dieser Bergwerksanlage betriebene Bergwerksmuseum ein
Vorzeigeobjekt, das ohne Übertreibung weltweit unbestritten ist. Als
denkmalgeschützte Anlage ist dieser Turm nicht nur ein Objekt örtlicher
Montanvergangenheit, sondern eine weit darüber hinausgehende Einrichtung,
die in der Fachwelt große Beachtung gefunden hat. Mit
dem Hydrokompressorenturm der 1992 stillgelegten Schachtanlage Knesebeck
hat das heute auf dieser Bergwerksanlage betriebene Bergwerksmuseum ein
Vorzeigeobjekt, das ohne Übertreibung weltweit unbestritten ist. Als
denkmalgeschützte Anlage ist dieser Turm nicht nur ein Objekt örtlicher
Montanvergangenheit, sondern eine weit darüber hinausgehende Einrichtung,
die in der Fachwelt große Beachtung gefunden hat.
 Wegen
dieser Einmaligkeit laufen derzeitig berechtigte Bestrebungen, dass diese
Anlage im Verbund mit der Oberharzer Wasserwirtschaft in das Weltkulturerbe
aufgenommen wird. Wegen
dieser Einmaligkeit laufen derzeitig berechtigte Bestrebungen, dass diese
Anlage im Verbund mit der Oberharzer Wasserwirtschaft in das Weltkulturerbe
aufgenommen wird.
 Wie
eingangs bereits angeführt, führt der Turm die Bezeichnung Hydrokompressorenturm,
auf die zunächst eingegangen werden muss, weil die Aufgliederung der
Wortzusammensetzung Hydrokompressorenturm nur zweideutig durch die Worte
Hydro und Kompressor ist. Aus diesen Worten ist Wasserverdichtung abzuleiten,
denn Hydro steht für Wasser und Kompressor für Verdichtung. Da
aber Wasser nach physikalischen Grundsätzen nicht verdichtet werden
kann, dürfte die Aussage der Zweideutigkeit begründet sein. Eindeutiger
dürfte deshalb die Bezeichnung Hydroluftkompressorenturm sein, weil
hier die Komponente Luft mit eingebaut ist. Wie
eingangs bereits angeführt, führt der Turm die Bezeichnung Hydrokompressorenturm,
auf die zunächst eingegangen werden muss, weil die Aufgliederung der
Wortzusammensetzung Hydrokompressorenturm nur zweideutig durch die Worte
Hydro und Kompressor ist. Aus diesen Worten ist Wasserverdichtung abzuleiten,
denn Hydro steht für Wasser und Kompressor für Verdichtung. Da
aber Wasser nach physikalischen Grundsätzen nicht verdichtet werden
kann, dürfte die Aussage der Zweideutigkeit begründet sein. Eindeutiger
dürfte deshalb die Bezeichnung Hydroluftkompressorenturm sein, weil
hier die Komponente Luft mit eingebaut ist.
 Der
Werdegang der Anlage am Knesebeck-Schacht zur Erzeugung von Druckluft durch
Wasser, geht auf die Jahre 1912/13 zurück und wurde von einer Entwicklung
aus Amerika übernommen. In einem Vortrag des Frankfurter Bezirksvereins
deutscher Ingenieure, gehalten von Prof. Gutermuth (Darmstadt) im Jahr
1900, wurde bereits auf die praktische Bedeutung der hydraulischen Lufterzeugung
verwiesen. In Amerika wurde die hydraulische Lufterzeugung von C. H. Tayler
entwickelt. Der
Werdegang der Anlage am Knesebeck-Schacht zur Erzeugung von Druckluft durch
Wasser, geht auf die Jahre 1912/13 zurück und wurde von einer Entwicklung
aus Amerika übernommen. In einem Vortrag des Frankfurter Bezirksvereins
deutscher Ingenieure, gehalten von Prof. Gutermuth (Darmstadt) im Jahr
1900, wurde bereits auf die praktische Bedeutung der hydraulischen Lufterzeugung
verwiesen. In Amerika wurde die hydraulische Lufterzeugung von C. H. Tayler
entwickelt.
 Ein
erster Versuchskompressor wurde in Deutschland in Villingen an der Saar,
im Auftrage des Wasserkraft-Druckluft-Syndikats in Mülheim an der
Ruhr, gebaut. Im Oberharzer Bergbaurevier sind in der Zeit von 1907 bis
1913 insgesamt sieben Anlagen errichtet worden, wovon drei im Grunder Revier
waren. Die anderen Standorte waren: Der Kaiser Wilhelm Schacht mit zwei
Anlagen, der Altensegener Schacht (beide in Clausthal), im Herzog Ernst
August Schacht in Bockswiese, sowie in Grund die am 4. Lichtloch des Tiefen
Georg-Stollens (Wiemannsbucht) und die im Hülfe Gottes Schacht. Ein
erster Versuchskompressor wurde in Deutschland in Villingen an der Saar,
im Auftrage des Wasserkraft-Druckluft-Syndikats in Mülheim an der
Ruhr, gebaut. Im Oberharzer Bergbaurevier sind in der Zeit von 1907 bis
1913 insgesamt sieben Anlagen errichtet worden, wovon drei im Grunder Revier
waren. Die anderen Standorte waren: Der Kaiser Wilhelm Schacht mit zwei
Anlagen, der Altensegener Schacht (beide in Clausthal), im Herzog Ernst
August Schacht in Bockswiese, sowie in Grund die am 4. Lichtloch des Tiefen
Georg-Stollens (Wiemannsbucht) und die im Hülfe Gottes Schacht. |
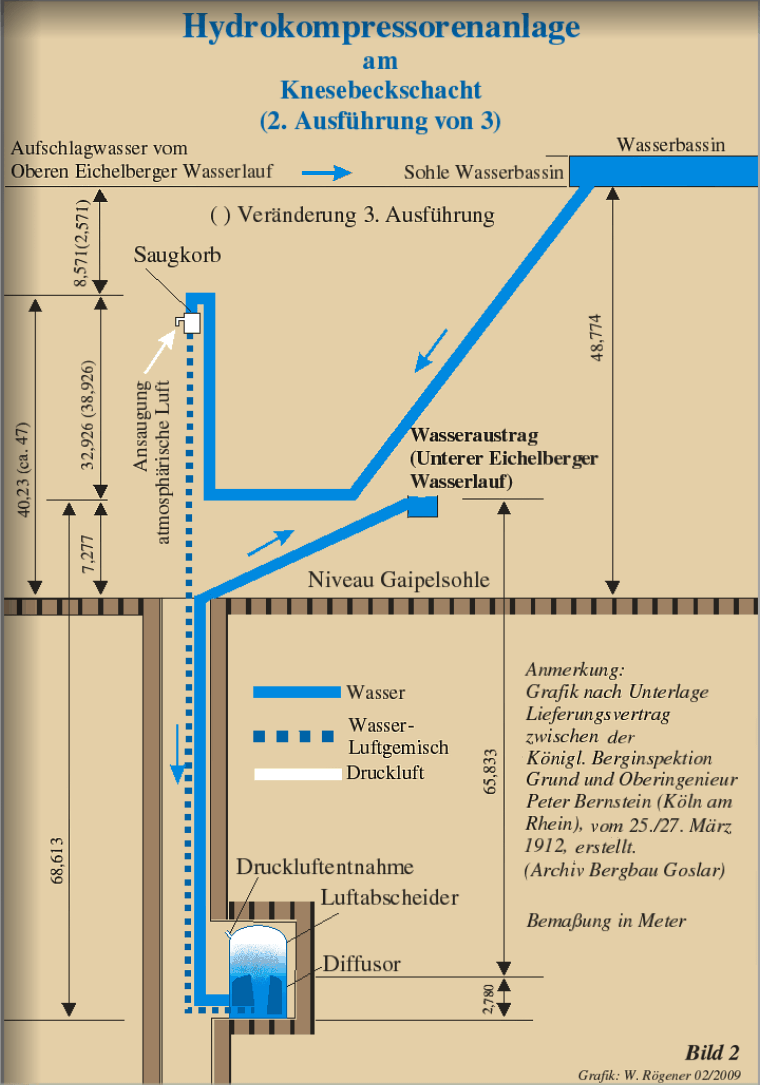 |
 Auf
der Schachtanlage Knesebeck hat sich die Anlegung einer solchen Anlage
deshalb angeboten, weil um 1900 die Wasserkunstanlagen durch die einsetzende
Elektrifizierung außer Betrieb genommen wurden und so das Wasser
einer anderen Nutzung zugeführt werden konnte. Druckluft war seit
dieser Zeit eine Energie, die besonders in Bergwerksbetrieben zum Einsatz
kam und bis auf den heutigen Tag auch noch ist. Auf
der Schachtanlage Knesebeck hat sich die Anlegung einer solchen Anlage
deshalb angeboten, weil um 1900 die Wasserkunstanlagen durch die einsetzende
Elektrifizierung außer Betrieb genommen wurden und so das Wasser
einer anderen Nutzung zugeführt werden konnte. Druckluft war seit
dieser Zeit eine Energie, die besonders in Bergwerksbetrieben zum Einsatz
kam und bis auf den heutigen Tag auch noch ist.
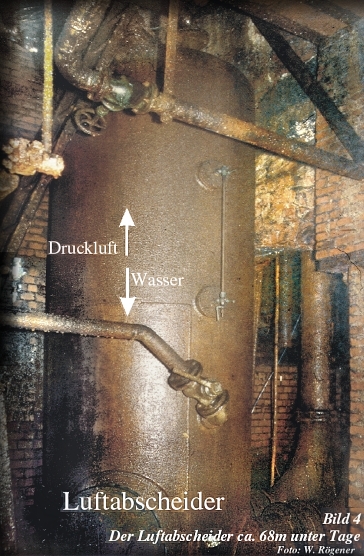  Die
Anlage zur hydraulischen Erzeugung von Druckluft am Knesebeck-Schacht wurde
von dem Oberingenieur Peter Bernstein aus Köln am Rhein erbaut. Über
den Bau wurde zwischen der Königlichen Berginspektion Grund und Bernstein
ein Lieferungsvertrag abgeschlossen, der in Köln am 25. März
1912 und am 27. März 1912 in Grund unterzeichnet wurde. In dem Vertrag
verpflichtete sich Bernstein für einen Gesamtpreis von 17 600 Mark
einen hydraulischen Luftkompressor für den Schacht Knesebeck, frei
Station Grund der Kleinbahn Gittelde-Grund, zu liefern. Die
Anlage zur hydraulischen Erzeugung von Druckluft am Knesebeck-Schacht wurde
von dem Oberingenieur Peter Bernstein aus Köln am Rhein erbaut. Über
den Bau wurde zwischen der Königlichen Berginspektion Grund und Bernstein
ein Lieferungsvertrag abgeschlossen, der in Köln am 25. März
1912 und am 27. März 1912 in Grund unterzeichnet wurde. In dem Vertrag
verpflichtete sich Bernstein für einen Gesamtpreis von 17 600 Mark
einen hydraulischen Luftkompressor für den Schacht Knesebeck, frei
Station Grund der Kleinbahn Gittelde-Grund, zu liefern.
 Im
Lieferungsvertrag garantierte Bernstein, dass bei einer nutzbaren Gefällehöhe
von 43m und einer Wassermenge von 10 bzw. 12m³/min eine stündliche
Saugleistung von 750m³ (Anm.: Ansaugen von atmosphärischer Luft)
nominal bzw. 900m³ maximal, eine Pressung der Luft auf 6,5 Atmosphären
erreicht wird. Als Toleranzgrenze sind 5% möglich. Für die angegebene
Leistung des Kompressors wird von Bernstein die Garantie übernommen,
dass bei 10m³/min Wasserzufluss unterhalb der Normalleistung von 750m³/Stunde
und der 5%igen Toleranz, 1% des Kaufpreises abgezogen werden können. Im
Lieferungsvertrag garantierte Bernstein, dass bei einer nutzbaren Gefällehöhe
von 43m und einer Wassermenge von 10 bzw. 12m³/min eine stündliche
Saugleistung von 750m³ (Anm.: Ansaugen von atmosphärischer Luft)
nominal bzw. 900m³ maximal, eine Pressung der Luft auf 6,5 Atmosphären
erreicht wird. Als Toleranzgrenze sind 5% möglich. Für die angegebene
Leistung des Kompressors wird von Bernstein die Garantie übernommen,
dass bei 10m³/min Wasserzufluss unterhalb der Normalleistung von 750m³/Stunde
und der 5%igen Toleranz, 1% des Kaufpreises abgezogen werden können.
 Zur
Person Bernstein muss angeführt werden, dass dieser ein ausgewiesener
Fachmann in Bezug hydraulische Erzeugung von Druckluft war. Der Hydrokompressor
am Knesebeckschacht erzeugte bei 10m³ Aufschlagwasser pro Minute rund
11m³/min Druckluft, entsprechend 660m³/Stunde mit 6atü Druckluftspannung
(bewußt die alte Bezeichnung gewählt). Im Vergleich zur möglichen
Gesamtdrucklufterzeugung der Kompressorenanlage auf der Schachtanlage der
Grube Hilfe Gottes, die mit 4 Schrauben- verdichtern 20128m³/Stunde
Druckluft (6 atü) erzeugen konnte, war eine installierte Leistung
von 2215kW erforderlich (Werksangabe vom 13.01.1988). Zur
Person Bernstein muss angeführt werden, dass dieser ein ausgewiesener
Fachmann in Bezug hydraulische Erzeugung von Druckluft war. Der Hydrokompressor
am Knesebeckschacht erzeugte bei 10m³ Aufschlagwasser pro Minute rund
11m³/min Druckluft, entsprechend 660m³/Stunde mit 6atü Druckluftspannung
(bewußt die alte Bezeichnung gewählt). Im Vergleich zur möglichen
Gesamtdrucklufterzeugung der Kompressorenanlage auf der Schachtanlage der
Grube Hilfe Gottes, die mit 4 Schrauben- verdichtern 20128m³/Stunde
Druckluft (6 atü) erzeugen konnte, war eine installierte Leistung
von 2215kW erforderlich (Werksangabe vom 13.01.1988).
 Nach
dem 2. Weltkrieg sind beim Erzbergwerk Grund zwei Hydrokompressorenanlagen
in Betrieb gewesen und zwar am Wiemannsbucht- und Knesebeck-Schacht. Beide
Anlagen haben fast gleiche Druckluftmengen erzeugt. Teilweise hat diese
erzeugte Menge die Undichtigkeiten im Druckluftnetz mit abgedeckt, die
immerhin bei einem gut gepflegten Druckluftnetz um die 15% betragen haben.
Der wesentliche Vorteil der Drucklufterzeugung unter Zuhilfenahme von Wasser
sind die geringen Erzeugungskosten. Nach
dem 2. Weltkrieg sind beim Erzbergwerk Grund zwei Hydrokompressorenanlagen
in Betrieb gewesen und zwar am Wiemannsbucht- und Knesebeck-Schacht. Beide
Anlagen haben fast gleiche Druckluftmengen erzeugt. Teilweise hat diese
erzeugte Menge die Undichtigkeiten im Druckluftnetz mit abgedeckt, die
immerhin bei einem gut gepflegten Druckluftnetz um die 15% betragen haben.
Der wesentliche Vorteil der Drucklufterzeugung unter Zuhilfenahme von Wasser
sind die geringen Erzeugungskosten. |
Quellen:
1)
Glückauf, Berg-und Hüttenmännische Zeitschrift; Nr. 29,
42 Jahrgang, 1906; 2) Compressed Air Magazine,1910, Vol.; 15, , No. 6;
3) Akten Erzbergwerk Grund |
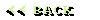 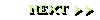
|