 |
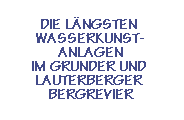
|
 (W.
R. Feb. 2011) Mit
der 50. Ausgabe berichtet der „Letzte Förderwagen“ diesmal aus unterschiedlichen
Bergrevieren und zwar aus dem Grunder und Lauterberger Revier, über
die längsten dort einstmals vorhandenen Wasserkunstanlagen. (W.
R. Feb. 2011) Mit
der 50. Ausgabe berichtet der „Letzte Förderwagen“ diesmal aus unterschiedlichen
Bergrevieren und zwar aus dem Grunder und Lauterberger Revier, über
die längsten dort einstmals vorhandenen Wasserkunstanlagen. |
|
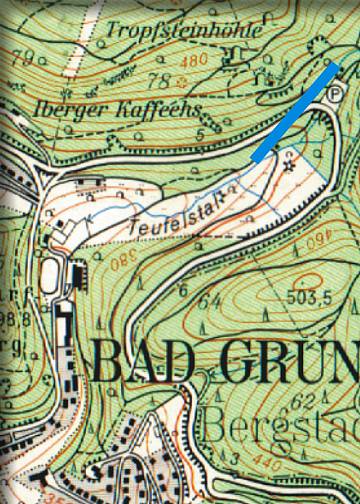 Bild 1
Bild 1 |
 Bei
der Wasserkunstanlage im Grunder Revier handelt es sich um die am Südosthang
des Ibergs gelegene Anlage der Grube Schüffelberg (siehe Bild 1).
Die Wasserkunstanlage war bereits 1680, wie aus Zeichnungen entnommen werden
kann, vorhanden. Das Feldgestänge (Verbindung Wasserrad bis Übergang
in den Schacht) der Anlage war ca. 320m lang. Bei
der Wasserkunstanlage im Grunder Revier handelt es sich um die am Südosthang
des Ibergs gelegene Anlage der Grube Schüffelberg (siehe Bild 1).
Die Wasserkunstanlage war bereits 1680, wie aus Zeichnungen entnommen werden
kann, vorhanden. Das Feldgestänge (Verbindung Wasserrad bis Übergang
in den Schacht) der Anlage war ca. 320m lang.
 Wesentlich
anders war dieses im Lauterberger Revier. Bei der ersten hier 1705 angelegten
Wasserkunstanlage war das Feldgestänge immerhin ca. 570m lang (siehe
Bild 3 u. 4), welches zu dieser Zeit schon eine Seltenheit war. Wesentlich
anders war dieses im Lauterberger Revier. Bei der ersten hier 1705 angelegten
Wasserkunstanlage war das Feldgestänge immerhin ca. 570m lang (siehe
Bild 3 u. 4), welches zu dieser Zeit schon eine Seltenheit war.
 Die
Wasserkunstanlage gehörte zur Kupfererzgrube Kupferrose, einer Grube
die nur eine relativ kurze Betriebszeit gehabt hat (1688-1748). In dieser
kurzen Betriebszeit wurden für diese Grube, ab 1705 für die Beaufschlagung
der Kunsträder durch Wasser, ca. 15 km Gräben angelegt. Ein Zeichen
dafür, welche Bedeutung die Grube gehabt hat. Die
Wasserkunstanlage gehörte zur Kupfererzgrube Kupferrose, einer Grube
die nur eine relativ kurze Betriebszeit gehabt hat (1688-1748). In dieser
kurzen Betriebszeit wurden für diese Grube, ab 1705 für die Beaufschlagung
der Kunsträder durch Wasser, ca. 15 km Gräben angelegt. Ein Zeichen
dafür, welche Bedeutung die Grube gehabt hat. |
 Bei
der Betrachtung der beiden Gruben, der Grube Schüffelberg im Grunder
Revier und der Grube Kupferrose im Lauterberger Revier, handelt es sich
jeweils um die ertragreichsten in ihren Revieren. Weiter kann nicht unerwähnt
bleiben, dass beide Orte die Bezeichnung Bergstadt führen durften,
wobei dieses für Lauterberg nur sehr, sehr kurz begrenzt war und Grund
bis auf den heutigen Tag die Bezeichnung noch führen kann (darf). Bei
der Betrachtung der beiden Gruben, der Grube Schüffelberg im Grunder
Revier und der Grube Kupferrose im Lauterberger Revier, handelt es sich
jeweils um die ertragreichsten in ihren Revieren. Weiter kann nicht unerwähnt
bleiben, dass beide Orte die Bezeichnung Bergstadt führen durften,
wobei dieses für Lauterberg nur sehr, sehr kurz begrenzt war und Grund
bis auf den heutigen Tag die Bezeichnung noch führen kann (darf). |
Zur
Wasserkunstanlage der Grube Schüffelberg
 Leider
liegen von der Wasserkunstanlage keine technischen Zeichnungen vor, wohl
aber wird in verschiedenen Zeichnungen die Anlage so dargestellt, wie im
Bild 2 gezeigt. Diese Zeichnung ist von Henniges Groscurt um 1680 erstellt
worden und befindet sich im Bergarchiv in CLZ. Weitere Zeichnungen, mit
ähnlicher Ausweisung der Wasserkunstanlage, befinden sich im Nds.
Staatsarchiv in Wolfenbüttel. Ersteller dieser Zeichnungen sind unter
anderem Remboldt und Ernesti. Weil die Wasserkunst in den Zeichnungen von
um 1680 nur durch Striche oder Kreuze ausgewiesen wurden, ist im Bild 2
eine Zeichnung von H.-J Boyke eingebaut, die zeigen soll, wie man sich
die Schüffelberger Wasserkunstanlage vorstellen kann. Leider
liegen von der Wasserkunstanlage keine technischen Zeichnungen vor, wohl
aber wird in verschiedenen Zeichnungen die Anlage so dargestellt, wie im
Bild 2 gezeigt. Diese Zeichnung ist von Henniges Groscurt um 1680 erstellt
worden und befindet sich im Bergarchiv in CLZ. Weitere Zeichnungen, mit
ähnlicher Ausweisung der Wasserkunstanlage, befinden sich im Nds.
Staatsarchiv in Wolfenbüttel. Ersteller dieser Zeichnungen sind unter
anderem Remboldt und Ernesti. Weil die Wasserkunst in den Zeichnungen von
um 1680 nur durch Striche oder Kreuze ausgewiesen wurden, ist im Bild 2
eine Zeichnung von H.-J Boyke eingebaut, die zeigen soll, wie man sich
die Schüffelberger Wasserkunstanlage vorstellen kann.
Zur Wasserkunstanlage
der Grube Kupferrose
 Über
diese Wasserkunstanlage und besonders über die wasserwirtschaftlichen
Anlagen der Grube Kupferrose liegen im Clausthaler Bergarchiv viele Dokumente
vor. Besondere Dokumente sind die Zeichnungen des Markscheiders Johann
Thomas Sartorius, der von der Außenstelle St. Andreasberg des Bergamts
Clausthal, das Lauterberger Revier markscheiderisch von 1721-1739 bearbeitet
hat. Einige der Zeichnungen von Sartorius, sind bis in die heutige Zeit
als Spitzenwerke zu bezeichnen. Über
diese Wasserkunstanlage und besonders über die wasserwirtschaftlichen
Anlagen der Grube Kupferrose liegen im Clausthaler Bergarchiv viele Dokumente
vor. Besondere Dokumente sind die Zeichnungen des Markscheiders Johann
Thomas Sartorius, der von der Außenstelle St. Andreasberg des Bergamts
Clausthal, das Lauterberger Revier markscheiderisch von 1721-1739 bearbeitet
hat. Einige der Zeichnungen von Sartorius, sind bis in die heutige Zeit
als Spitzenwerke zu bezeichnen.
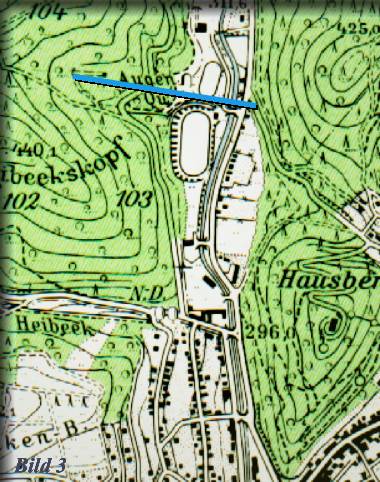  Eine
weitere markscheiderisch im Lauterberger Revier tätige Persönlichkeit
ist der Vorgänger von Sartorius, der in Personalunion als Einfahrer
und Markscheider tätig gewesene Andreas Leopold Hartzig. Die anerkannte
Fachkompetenz wurde Hartzig schon im Alter von 19 Jahren zugesprochen.
Hartzig hat zwei Planungsobjekte auf den Weg gebracht, die bis in die heutige
Zeit hinein Beachtung finden. Es handelt es sich hier um den Damm des Wiesenbecker
Teichs, der von ihm geplant wurde (1715). Diese Planungskonzeption
ist fest verankert in der montanen Wasserwirtschaft und zwar unter dem
Namen „Lauterberger Dammbauweise“ Eine
weitere markscheiderisch im Lauterberger Revier tätige Persönlichkeit
ist der Vorgänger von Sartorius, der in Personalunion als Einfahrer
und Markscheider tätig gewesene Andreas Leopold Hartzig. Die anerkannte
Fachkompetenz wurde Hartzig schon im Alter von 19 Jahren zugesprochen.
Hartzig hat zwei Planungsobjekte auf den Weg gebracht, die bis in die heutige
Zeit hinein Beachtung finden. Es handelt es sich hier um den Damm des Wiesenbecker
Teichs, der von ihm geplant wurde (1715). Diese Planungskonzeption
ist fest verankert in der montanen Wasserwirtschaft und zwar unter dem
Namen „Lauterberger Dammbauweise“
 Weiter
zeichnet Hartzig verantwortlich für den Bau des rund 1000m langen
und 16m hohen Sperrberhaier Damms, der südwestlich von Altenau direkt
an der B 242 liegt (erbaut 1732-1734). Durch den über den Damm
führenden Graben wurde das Clausthaler Revier an das Wassereinzugsgebiets
des Brockens angeschlossen. Weiter
zeichnet Hartzig verantwortlich für den Bau des rund 1000m langen
und 16m hohen Sperrberhaier Damms, der südwestlich von Altenau direkt
an der B 242 liegt (erbaut 1732-1734). Durch den über den Damm
führenden Graben wurde das Clausthaler Revier an das Wassereinzugsgebiets
des Brockens angeschlossen.
 Hartzig
besondere Leistungen fanden ihre Krönung dadurch, dass er den zweithöchsten
Rang eines Bergbeamten erreicht hat, und zwar den eines Oberbergmeisters,
eine Position die unmittelbar unter der des Berghauptmanns steht. Hartzig
besondere Leistungen fanden ihre Krönung dadurch, dass er den zweithöchsten
Rang eines Bergbeamten erreicht hat, und zwar den eines Oberbergmeisters,
eine Position die unmittelbar unter der des Berghauptmanns steht.
 Seine
ersten Sporen dürfte Hartzig sich im Lauterberger Bergrevier mit dem
Bau der ersten Wasserkunstanlage (1705) für die Grube Kupferrose erworben
haben. Einen Eindruck von dieser Anlage vermittelt Bild 4. Durch das Bild
wird uns eine gute Lagezuweisung vermittelt und man kann dadurch auch heute
noch gut den Verlauf des Feldgestänges der Wasserkunstanlage nachvollziehen Seine
ersten Sporen dürfte Hartzig sich im Lauterberger Bergrevier mit dem
Bau der ersten Wasserkunstanlage (1705) für die Grube Kupferrose erworben
haben. Einen Eindruck von dieser Anlage vermittelt Bild 4. Durch das Bild
wird uns eine gute Lagezuweisung vermittelt und man kann dadurch auch heute
noch gut den Verlauf des Feldgestänges der Wasserkunstanlage nachvollziehen
 Das
Aufschlagwasser für das Kunstrad wurde über einen ca. 800m langen
Graben herangeführt. Eingespeist für diesen Graben wurde das
Wasser in Höhe der ehemaligen Kupferhütte (heutiges Forstamt),
aus dem Bach der Krummen Lutter. Das
Aufschlagwasser für das Kunstrad wurde über einen ca. 800m langen
Graben herangeführt. Eingespeist für diesen Graben wurde das
Wasser in Höhe der ehemaligen Kupferhütte (heutiges Forstamt),
aus dem Bach der Krummen Lutter.
 Wie
im Bild 4 ersichtlich sind zwei weitere Wasserkunstanlagen zu sehen, welche
die erste Anlage ersetzt haben und bis zum Ende der Betriebszeit der Grube
Kupferrose (1748) in Betrieb waren. Wie
im Bild 4 ersichtlich sind zwei weitere Wasserkunstanlagen zu sehen, welche
die erste Anlage ersetzt haben und bis zum Ende der Betriebszeit der Grube
Kupferrose (1748) in Betrieb waren. |