 |
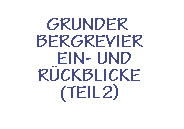
|
 ((W.
R. Sept. 2009) Nachdem
im Teil 1 der Ein- und Rückblicke
im Grunder Bergrevier auf heutige Informationsstellen (Letzter Förderwagen
und Bergbaumuseum) sowie auf zwei bedeutende ((W.
R. Sept. 2009) Nachdem
im Teil 1 der Ein- und Rückblicke
im Grunder Bergrevier auf heutige Informationsstellen (Letzter Förderwagen
und Bergbaumuseum) sowie auf zwei bedeutende |
|

Bild
3 Knesebeck-Schacht |
| Wasserlösungsstollen
(Magdeburger- und Tiefer Georg-Stollen) verwiesen wurde, werden hier die
vier Tagesschächte der letzten Betriebsphase des Erzbergwerks Grund
ins Blickfeld gerückt. |
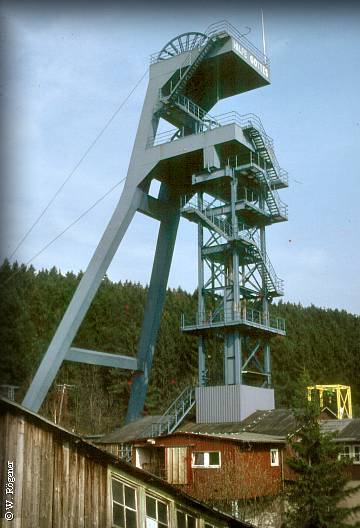 Bild 1 Achenbach-Schacht
Bild 1 Achenbach-Schacht |
 Mit
Ausnahme des Westschachts (Bild 4),
der im März/April 1999 durch den Museumsverein Bindweide (Siegerland)
demontiert wurde, sind der Achenbach-Schacht (Bild
1), der Wiemannsbuchtschacht (Bild
2) und der Knesebeck-Schacht (Bild
3) heute noch sichtbare Symbole der Grunder
Bergbaugeschichte. Mit
Ausnahme des Westschachts (Bild 4),
der im März/April 1999 durch den Museumsverein Bindweide (Siegerland)
demontiert wurde, sind der Achenbach-Schacht (Bild
1), der Wiemannsbuchtschacht (Bild
2) und der Knesebeck-Schacht (Bild
3) heute noch sichtbare Symbole der Grunder
Bergbaugeschichte.
Der Achenbach-Schacht
(siehe
auch Allg. Harz-Berg-Kalender 2008, S. 67-69).
Benannt
wurde der Schacht nach Adolf Achenbach (1825-1903), der von 1878 bis 1900
das hohe Amt des Berghauptmanns ausgeübt hat. Der Schacht wurde in
insgesamt fünf Teufphasen (1904/07, 1913, 1934/35, 1965 und 1971/72)
abgeteuft. Im Jahr 1972 wurde die Endteufe (Endtiefe) mit 713,38m erreicht.
 Im
Laufe der Betriebszeit hat der Schacht immer wieder Anpassungsphasen durchlebt,
die zum Ziel hatten, die wirtschaftliche Basis des Bergwerksbetriebs zu
verbessern. Erbrachte der Schacht im Jahr 1916 eine Jahresförderung
von 66 000 Tonnen Roherz, so waren es 463 000 Tonnen Roherz im Jahr 1976.
Es war dieses die höchste Jahresfördermenge, die jemals über
einen Schacht innerhalb des Grunder Reviers und auch des Oberharzer Gangerzreviers
erreicht wurde. Unter den vier Schächten war der Schacht der wichtigste
des Erzbergwerks Grund und führte deshalb auch die Bezeichnung Hauptförderschacht.
Die anderen Schächte wurden als Nebenschächte bezeichnet. Rund
um die Uhr war der Schacht in Betrieb, das heißt 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche und so Monat für Monat. Im
Laufe der Betriebszeit hat der Schacht immer wieder Anpassungsphasen durchlebt,
die zum Ziel hatten, die wirtschaftliche Basis des Bergwerksbetriebs zu
verbessern. Erbrachte der Schacht im Jahr 1916 eine Jahresförderung
von 66 000 Tonnen Roherz, so waren es 463 000 Tonnen Roherz im Jahr 1976.
Es war dieses die höchste Jahresfördermenge, die jemals über
einen Schacht innerhalb des Grunder Reviers und auch des Oberharzer Gangerzreviers
erreicht wurde. Unter den vier Schächten war der Schacht der wichtigste
des Erzbergwerks Grund und führte deshalb auch die Bezeichnung Hauptförderschacht.
Die anderen Schächte wurden als Nebenschächte bezeichnet. Rund
um die Uhr war der Schacht in Betrieb, das heißt 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche und so Monat für Monat. |
 In
den Jahren 1933 und 1973 wurden die Fördermaschinen erneuert. Die
Erneuerung der Fördermaschine 1933 erforderte auch die gleichzeitige
Erhöhung des Fördergerüstes. Die 1933 eingebaute Gleichstromfördermaschine
mit konischen Seiltrommeln wurde 1960 und 1966 nochmals mechanisch und
elektrisch umgebaut. In
den Jahren 1933 und 1973 wurden die Fördermaschinen erneuert. Die
Erneuerung der Fördermaschine 1933 erforderte auch die gleichzeitige
Erhöhung des Fördergerüstes. Die 1933 eingebaute Gleichstromfördermaschine
mit konischen Seiltrommeln wurde 1960 und 1966 nochmals mechanisch und
elektrisch umgebaut.
 Durch
den Umbau konnten mit dieser Fördermaschine Nutzlasten von drei Tonnen
bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 9m/sec. aus 600m Teufe
gehoben werden. Diese Fördermaschine ist heute noch vorhanden und
wurde 1973 außer Betrieb genommen. Im gleichen Jahr erhielt der Schacht
eine neue elektronisch ferngesteuerte Gleichstromfördermaschine (1280
kW) mit einer sogenannten Koepescheibe (6m Durchmesser). Maximal konnten
jetzt 9 Tonnen Nutzlast gehoben werden. Die Fördergeschwindigkeit
betrug bei der Erzförderung maximal 16m/sec. (entsprechend ca. 58
km/h), bei der Personenbeförderung maximal 12m/sec. (ca. 43km/h).
Nach meinen Informationen ist diese Fördermaschine heute nicht mehr
vorhanden. Sie soll verschrottet worden sein. Für mich und für
technisch Interessierte eine sehr bedauerliche Vorgehensweise. Durch
den Umbau konnten mit dieser Fördermaschine Nutzlasten von drei Tonnen
bei einer maximalen Fördergeschwindigkeit von 9m/sec. aus 600m Teufe
gehoben werden. Diese Fördermaschine ist heute noch vorhanden und
wurde 1973 außer Betrieb genommen. Im gleichen Jahr erhielt der Schacht
eine neue elektronisch ferngesteuerte Gleichstromfördermaschine (1280
kW) mit einer sogenannten Koepescheibe (6m Durchmesser). Maximal konnten
jetzt 9 Tonnen Nutzlast gehoben werden. Die Fördergeschwindigkeit
betrug bei der Erzförderung maximal 16m/sec. (entsprechend ca. 58
km/h), bei der Personenbeförderung maximal 12m/sec. (ca. 43km/h).
Nach meinen Informationen ist diese Fördermaschine heute nicht mehr
vorhanden. Sie soll verschrottet worden sein. Für mich und für
technisch Interessierte eine sehr bedauerliche Vorgehensweise.
 Die
gesamte Erzförderung des Erzbergwerks Grund (Grube Hilfe Gottes und
Grube Bergwerkswohlfahrt) erfolgte seit 1931 über den Achenbach-Schacht.
Ab 1973 konnten in ca. zwei Minuten ca. 6,4 Tonnen Roherz aus rund 700m
Teufe zu Tage gefördert werden. Zwei gegenläufig im Schacht verkehrende
dreitägige Förderkörbe wurden auf der unteren und mittleren
Etage mit je zwei Förderwagen pro Etage beschickt (Wageninhalt 1000
Liter). Die obere Etage des Förderkorbs blieb frei und stand in Ausnahmefällen
für Personenfahrten zur Verfügung. Die
gesamte Erzförderung des Erzbergwerks Grund (Grube Hilfe Gottes und
Grube Bergwerkswohlfahrt) erfolgte seit 1931 über den Achenbach-Schacht.
Ab 1973 konnten in ca. zwei Minuten ca. 6,4 Tonnen Roherz aus rund 700m
Teufe zu Tage gefördert werden. Zwei gegenläufig im Schacht verkehrende
dreitägige Förderkörbe wurden auf der unteren und mittleren
Etage mit je zwei Förderwagen pro Etage beschickt (Wageninhalt 1000
Liter). Die obere Etage des Förderkorbs blieb frei und stand in Ausnahmefällen
für Personenfahrten zur Verfügung. |

Bild
2 Wiemannsbuchtschacht |
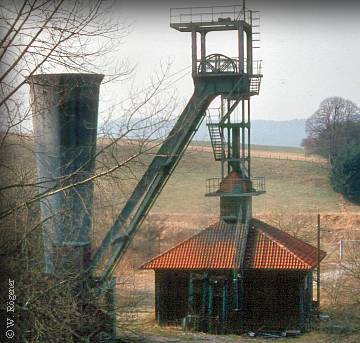
Bild
4 Westschacht |
 Während
der Erzförderung waren drei Personen als Bedienungspersonal eingesetzt.
Zwei waren auf der tiefsten Sohle (Beschickungssohle) eingesetzt und eine
über Tage, auf der sogenannten Hängebank. Auf der Beschickungssohle
hatte eine Person die Aufgabe die Förderwagen zu befüllen (Wuchtrinnenbetrieb)
und die andere die Förderwagen über eine druckluftbeaufschlagte
Aufschiebevorrichtung auf den Förderkorb zu „schieben“. Die Person
auf der Hängebank, die gleichzeitig auch als Fördermaschinist
ausgebildet war, musste die beladenen Förderwagen mithilfe der druckluftbetätigten
Abschiebevorrichtung vom Förderkorb „abschieben“. Während
der Erzförderung waren drei Personen als Bedienungspersonal eingesetzt.
Zwei waren auf der tiefsten Sohle (Beschickungssohle) eingesetzt und eine
über Tage, auf der sogenannten Hängebank. Auf der Beschickungssohle
hatte eine Person die Aufgabe die Förderwagen zu befüllen (Wuchtrinnenbetrieb)
und die andere die Förderwagen über eine druckluftbeaufschlagte
Aufschiebevorrichtung auf den Förderkorb zu „schieben“. Die Person
auf der Hängebank, die gleichzeitig auch als Fördermaschinist
ausgebildet war, musste die beladenen Förderwagen mithilfe der druckluftbetätigten
Abschiebevorrichtung vom Förderkorb „abschieben“.
 Sowohl
auf der Beschickungssohle als auch auf der Hängebank war der Wagenumlauf
voll automatisiert. Die mit der Beschickung des Förderkorbes tätigen
Personen hatten, wenn die Förderwagen auf den Förderkorb geschoben
waren, lediglich ein „Fertigsignal“ zu betätigen, um dann den automatischen
Förderbetrieb im Schacht in Gang zu setzen. Sowohl
auf der Beschickungssohle als auch auf der Hängebank war der Wagenumlauf
voll automatisiert. Die mit der Beschickung des Förderkorbes tätigen
Personen hatten, wenn die Förderwagen auf den Förderkorb geschoben
waren, lediglich ein „Fertigsignal“ zu betätigen, um dann den automatischen
Förderbetrieb im Schacht in Gang zu setzen.
Nach
Beendigung der Abschlussmaßnahmen im Grubengebäude, wurde der
Schacht ab oberhalb der 4. Sohle bis zur Tagesoberfläche durch Verfüllung
verschlossen. |
Der
Wiemannsbuchtschacht
 Der
östlichste Schacht des Erzbergwerks Grund ist der Wiemannsbuchtschacht,
der sich im Grubenfeld der Grube Bergwerkswohlfahrt befindet. Der Wiemannsbuchtschacht
ist aus dem Blindschacht 2 hervorgegangen (Anmerkung: ein Blindschacht
ist ein nicht zutage gehender Schacht). Im April 1951 wurde die Verbindung
von über Tage zum Blindschacht hergestellt. Der Blindschacht wurde
so zum Tagesschacht. Ca. 320m Abteufarbeit waren nötig, um von Februar
1949 bis April 1951 diese Verbindung herzustellen. Der Schacht hat eine
Gesamteufe (Tiefe) von 761,65m, die in acht Teufperioden von 1919 bis Anfang
der 1970-er Jahre erreicht wurde. Siebzehn Sohlenabgänge gehen vom
Schacht ab und führen ins Feld. Der
östlichste Schacht des Erzbergwerks Grund ist der Wiemannsbuchtschacht,
der sich im Grubenfeld der Grube Bergwerkswohlfahrt befindet. Der Wiemannsbuchtschacht
ist aus dem Blindschacht 2 hervorgegangen (Anmerkung: ein Blindschacht
ist ein nicht zutage gehender Schacht). Im April 1951 wurde die Verbindung
von über Tage zum Blindschacht hergestellt. Der Blindschacht wurde
so zum Tagesschacht. Ca. 320m Abteufarbeit waren nötig, um von Februar
1949 bis April 1951 diese Verbindung herzustellen. Der Schacht hat eine
Gesamteufe (Tiefe) von 761,65m, die in acht Teufperioden von 1919 bis Anfang
der 1970-er Jahre erreicht wurde. Siebzehn Sohlenabgänge gehen vom
Schacht ab und führen ins Feld.
 Der
Schachtquerschnitt ist kreisrund. Der Durchmesser ist unterschiedlich und
beträgt 3,5m bzw. 4,0 m. Der
Schachtquerschnitt ist kreisrund. Der Durchmesser ist unterschiedlich und
beträgt 3,5m bzw. 4,0 m.
 Den
Blindschacht 2 zum Tagesschacht zu machen war erforderlich geworden, weil
die Anfahrwege zum Arbeitsort der bislang im Meding-Schacht anfahrenden
Bergleute immer länger wurden und der Erzabbau bekannterweise immer
weiter sich nach Westen entwickelt hat. Durch Schaffung des neuen Tagesschachtes
wurde auch die Belegschaft vom Medingschacht zur Schachtanlage Wiemannsbucht
verlegt. Den
Blindschacht 2 zum Tagesschacht zu machen war erforderlich geworden, weil
die Anfahrwege zum Arbeitsort der bislang im Meding-Schacht anfahrenden
Bergleute immer länger wurden und der Erzabbau bekannterweise immer
weiter sich nach Westen entwickelt hat. Durch Schaffung des neuen Tagesschachtes
wurde auch die Belegschaft vom Medingschacht zur Schachtanlage Wiemannsbucht
verlegt.
 Bis
zu Anfang der 1970-er Jahre war der Wiemannsbuchtschacht Seilfahrtsschacht,
Bergeförderschacht, diente zur Erzförderung in der Zwischenförderung,
worunter die Förderung innerhalb des Schachtes von unterschiedlichen
Sohlen zu verstehen ist und weiter als Materialschacht für Grubenholz
und dergleichen. Bis
zu Anfang der 1970-er Jahre war der Wiemannsbuchtschacht Seilfahrtsschacht,
Bergeförderschacht, diente zur Erzförderung in der Zwischenförderung,
worunter die Förderung innerhalb des Schachtes von unterschiedlichen
Sohlen zu verstehen ist und weiter als Materialschacht für Grubenholz
und dergleichen.
 Nach
einer Umbauzeit von gut sechs Jahren hat der Schacht ab Anfang der 1970-er
Jahre neue Schachteinbauten erhalten, die ohne den laufenden Betrieb zu
unterbrechen, an Wochenenden und jährlichen Betriebsferien eingebaut
wurden. Ziel der Umbauarbeiten war, dass der Schacht nur zur Bergeförderung
genutzt werden sollte. Die Gestellförderung (Wagenförderung auf
Förderkörben) wurde auf Gefäßförderung (Skipförderung)
umgestellt. Hierunter ist zu verstehen, dass anstelle eines Förderkorbs
ein Gefäß (Behälter; 1,75rm³ Inhalt) im Schacht auf
der einen Seite auf und ab bewegt wird und auf der anderen Seite ein Förderkorb,
der mit beladenen Förderwagen (2) als Gegengewicht dient. Weiter
hat der Schacht im Rahmen der Umbaumaßnahmen anstelle der bisherigen
zylindrischen Trommelfördermaschine eine Koepe-Fördermaschine
(wie der Achenbach-Schacht) mit einer Leistung von 315 kW erhalten. Die
Fördergeschwindigkeit wurde von bislang 5,5m/sec (ca.20 km/h) auf
12m/sec (ca. 43 km/h) erhöht. Nach
einer Umbauzeit von gut sechs Jahren hat der Schacht ab Anfang der 1970-er
Jahre neue Schachteinbauten erhalten, die ohne den laufenden Betrieb zu
unterbrechen, an Wochenenden und jährlichen Betriebsferien eingebaut
wurden. Ziel der Umbauarbeiten war, dass der Schacht nur zur Bergeförderung
genutzt werden sollte. Die Gestellförderung (Wagenförderung auf
Förderkörben) wurde auf Gefäßförderung (Skipförderung)
umgestellt. Hierunter ist zu verstehen, dass anstelle eines Förderkorbs
ein Gefäß (Behälter; 1,75rm³ Inhalt) im Schacht auf
der einen Seite auf und ab bewegt wird und auf der anderen Seite ein Förderkorb,
der mit beladenen Förderwagen (2) als Gegengewicht dient. Weiter
hat der Schacht im Rahmen der Umbaumaßnahmen anstelle der bisherigen
zylindrischen Trommelfördermaschine eine Koepe-Fördermaschine
(wie der Achenbach-Schacht) mit einer Leistung von 315 kW erhalten. Die
Fördergeschwindigkeit wurde von bislang 5,5m/sec (ca.20 km/h) auf
12m/sec (ca. 43 km/h) erhöht.
 Unter
Tage musste mit einer Schrapperanlage ein Vorratsbehälter befüllt
werden, von dem aus dann das im Schacht laufende Gefäß automatisch
befüllt wurde. Über Tage wurde das Skipgefäß automatisch
an ein Übergabegefäß entleert. Der Inhalt dieses Gefäßes
wurde von der über Tage tätigen Person in ein gummibereiftes
Muldenfahrzeug entleert. Das Bergegut wurde dann zur Haldenkippe gefahren.
Die über Tage tätige Person war befähigt die Fördermaschine
„von Hand“ zu fahren, um so Personenfahrten oder Materialeinhänge
zu ermöglichen. Unter
Tage musste mit einer Schrapperanlage ein Vorratsbehälter befüllt
werden, von dem aus dann das im Schacht laufende Gefäß automatisch
befüllt wurde. Über Tage wurde das Skipgefäß automatisch
an ein Übergabegefäß entleert. Der Inhalt dieses Gefäßes
wurde von der über Tage tätigen Person in ein gummibereiftes
Muldenfahrzeug entleert. Das Bergegut wurde dann zur Haldenkippe gefahren.
Die über Tage tätige Person war befähigt die Fördermaschine
„von Hand“ zu fahren, um so Personenfahrten oder Materialeinhänge
zu ermöglichen.
 Im
Rahmen der Schließungsmaßnahmen wurde der Schacht voll verschlossen. Im
Rahmen der Schließungsmaßnahmen wurde der Schacht voll verschlossen. |
|