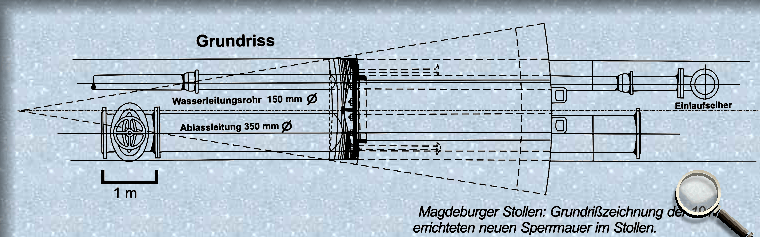Eisen und Silber
 Der
Bergbau ging in Bad Grund wie auch sonst überall im Oberharz bereits
im Mittelalter um, hatte aber noch keine größere Bedeutung und
kam bereits um 1350 durch die große Pestepidemie zum Erliegen. Die
Eisensteingruben am Iberg bei Bad Grund förderten allerdings weiter.
Im Jahre 1430 wurde dieser Bergbau erstmals urkundlich erwähnt. Einen
nachhaltigen Aufschwung erlangte der Grundner Bergbau Ende des 15.Jahrhunderts
unter Herzog Heinrich d. J., der zur weiteren Belebung dieses Reviers 1524
die erste Bergordnung des Harzes für Grund erließ. Grund hatte
zu dieser Zeit durch einsetzende Silberfunde die Rechte einer Bergstadt
erhalten, war aber immer noch Eisenhüttensiedlung. Der
Bergbau ging in Bad Grund wie auch sonst überall im Oberharz bereits
im Mittelalter um, hatte aber noch keine größere Bedeutung und
kam bereits um 1350 durch die große Pestepidemie zum Erliegen. Die
Eisensteingruben am Iberg bei Bad Grund förderten allerdings weiter.
Im Jahre 1430 wurde dieser Bergbau erstmals urkundlich erwähnt. Einen
nachhaltigen Aufschwung erlangte der Grundner Bergbau Ende des 15.Jahrhunderts
unter Herzog Heinrich d. J., der zur weiteren Belebung dieses Reviers 1524
die erste Bergordnung des Harzes für Grund erließ. Grund hatte
zu dieser Zeit durch einsetzende Silberfunde die Rechte einer Bergstadt
erhalten, war aber immer noch Eisenhüttensiedlung.
Der Stollen
  Neben
dem Herzog zeigten zu dieser Zeit auch größere Städte Interesse
am Bergbau im Harz und bildeten Gewerkschaften zur finanziellen Unterstützung
der Grubenbetriebe. Im Bereich von Grund waren Gewerke aus Magdeburg besonders
aktiv und auf Silberfunde aus. Im Jahre 1527 begannen sie mit dem Auffahren
eines tiefen Stollens zur Entwässerung der neuen Gruben. Der Stollen
wurde vom Hübichtal unter dem Iberg vorgetrieben. Bereits damals wurde
er nach seinen Betreibern „Magdeburger Stollen“ genannt. Nach und nach
wurden alle Grubenbetriebe am Iberg an diesen für den nachhaltigen
Betrieb der Abbaue notwendigen Wasserlösungsstollen angeschlossen.
Insgesamt erstreckt sich der Magdeburger Stollen über mehr als 2000
m im Iberg. Es folgte eine allerdings nur kurze Blütezeit der Silbergruben
in Grund. Vor allem wegen technischer Schwierigkeiten kam der Edelmetallbergbau
bereits vor 1550 zum erliegen. Einzig der Eisenerzabbau hatte am Iberg
Fortbestand. Letzter Betreiber der Eisengruben war der „Hörder Bergwerks-
und Hüttenverein“. Die Förderung endete 1885. Neben
dem Herzog zeigten zu dieser Zeit auch größere Städte Interesse
am Bergbau im Harz und bildeten Gewerkschaften zur finanziellen Unterstützung
der Grubenbetriebe. Im Bereich von Grund waren Gewerke aus Magdeburg besonders
aktiv und auf Silberfunde aus. Im Jahre 1527 begannen sie mit dem Auffahren
eines tiefen Stollens zur Entwässerung der neuen Gruben. Der Stollen
wurde vom Hübichtal unter dem Iberg vorgetrieben. Bereits damals wurde
er nach seinen Betreibern „Magdeburger Stollen“ genannt. Nach und nach
wurden alle Grubenbetriebe am Iberg an diesen für den nachhaltigen
Betrieb der Abbaue notwendigen Wasserlösungsstollen angeschlossen.
Insgesamt erstreckt sich der Magdeburger Stollen über mehr als 2000
m im Iberg. Es folgte eine allerdings nur kurze Blütezeit der Silbergruben
in Grund. Vor allem wegen technischer Schwierigkeiten kam der Edelmetallbergbau
bereits vor 1550 zum erliegen. Einzig der Eisenerzabbau hatte am Iberg
Fortbestand. Letzter Betreiber der Eisengruben war der „Hörder Bergwerks-
und Hüttenverein“. Die Förderung endete 1885.
Trinkwasser für
die Bergstadt
 Bereits
bei seiner Auffahrung zeigte sich, daß dieser Stollen nicht nur als
Wasserlösungsstollen für die Gruben diente, sondern zugleich
Trinkwasserversorger für die Bergstadt sein sollte.
Schon beim Stollenbau wurde klares Gebirgswasser abgefangen und dank der
guten Qualität den Haushalten und Hüttenbetrieben zur Verfügung
gestellt. Zur Ableitung gab es damals bereits Wasserleitungen aus Holz,
die sogenannten Pipen. Bei Ausschachtungsarbeiten wurden häufig Reste
dieser Wasserleitung gefunden. (Sie sind im Bergbaumuseum zu besichtigen)
Durch den Magdeburger Stollen verfügten die Grundner Bürger ab
dieser Zeit über ausgezeichnetes und ausreichendes Trinkwasser. Einzig
in den Jahren 1767 und 1823 war das Wasser durch zuvorige Sommerdürren
und frostige,schneelose Winter knapp. Am 18.Oktober 1868 war der Magdeburger
Stollen allerdings versiegt. Die Mühlen standen still und die Strassenbrunnen
hörten auf zu laufen. Der Grund: Vom Knesebeckschacht aus war ein
tiefer Stollen in den Iberg getrieben worden. Dieser lag ca.130 m unter
dem Magdeburger Stollen und hatte dessen Wasser abgefangen. Über einen
Zeitraum von 10 Jahren behalf sich die Bergstadt mit Wasser von minderer
Qualität. Im Juni 1878 erfolgte letztendlich die Abschottung des Knesebecker
Stollens mit einem unterirdischen Damm. Erst im Januar 1879, über
200 Tage später, waren die Hohlräume des Ibergs wieder mit (nach
damaliger Berechnung 1,2 Mio. m³) Wasser gefüllt und flossen
wieder aus dem Magdeburger Stollen. Bereits
bei seiner Auffahrung zeigte sich, daß dieser Stollen nicht nur als
Wasserlösungsstollen für die Gruben diente, sondern zugleich
Trinkwasserversorger für die Bergstadt sein sollte.
Schon beim Stollenbau wurde klares Gebirgswasser abgefangen und dank der
guten Qualität den Haushalten und Hüttenbetrieben zur Verfügung
gestellt. Zur Ableitung gab es damals bereits Wasserleitungen aus Holz,
die sogenannten Pipen. Bei Ausschachtungsarbeiten wurden häufig Reste
dieser Wasserleitung gefunden. (Sie sind im Bergbaumuseum zu besichtigen)
Durch den Magdeburger Stollen verfügten die Grundner Bürger ab
dieser Zeit über ausgezeichnetes und ausreichendes Trinkwasser. Einzig
in den Jahren 1767 und 1823 war das Wasser durch zuvorige Sommerdürren
und frostige,schneelose Winter knapp. Am 18.Oktober 1868 war der Magdeburger
Stollen allerdings versiegt. Die Mühlen standen still und die Strassenbrunnen
hörten auf zu laufen. Der Grund: Vom Knesebeckschacht aus war ein
tiefer Stollen in den Iberg getrieben worden. Dieser lag ca.130 m unter
dem Magdeburger Stollen und hatte dessen Wasser abgefangen. Über einen
Zeitraum von 10 Jahren behalf sich die Bergstadt mit Wasser von minderer
Qualität. Im Juni 1878 erfolgte letztendlich die Abschottung des Knesebecker
Stollens mit einem unterirdischen Damm. Erst im Januar 1879, über
200 Tage später, waren die Hohlräume des Ibergs wieder mit (nach
damaliger Berechnung 1,2 Mio. m³) Wasser gefüllt und flossen
wieder aus dem Magdeburger Stollen.
Vom
13. bis 14. August 1784 weilte der „Dichterfürst“ Johann -Wolfgang
von Goethe auf seiner 3. Harzreise, in den Mauern unseres Harzstädtchens
und fuhr mit dem Vizeberghauptmann von Trebra
aus Zellerfeld in den „Magdeburger Stollen“ ein.
Eine unterirdische
Talsperre
 1881
wurde der Stollen für die Erzgewinnung aufgegeben. Um die Trinkwasserversorgung
sicherer zu gewährleisten, wurden in den Iberger Stollensystemen Dämme
zur Erschließung weiterer Bergwässer errichtet, zudem wurden
die Holzpipen gegen gußeiserne Druckrohre ausgetauscht. Im Jahre
1885 übertrug der Hörder Bergwerks-und Hüttenverein den
Magdeburger Stollen in das Eigentum der Bergstadt Bad Grund. Seither dient
er – bis zum heutigen Tage ausschließlich der Wasserversorgung. Zur
Erhöhung des Wasservorrates und –drucks wurde 1911 etwa 280 m vom
Stollenmundloch entfernt eine Sperrmauer errichtet. Dieser Stauraum riegelt
das System Magdeburger Stollen vollständig ab. Das Wasser im Iberg
konnte danach um weitere fast 20 m ansteigen, bevor es aus anderen Stollen
überlaufend zutage trat. Der mit über 1 Mio. m³ berechnete
Wasservorrat dieser unterirdischen Talsperre reicht auch für die heutigen
Bedürfnisse der Wasserversorgung der Samtgemeinde Bad Grund (Harz).
Pro Jahr werden aus dem Magdeburger Stollen über 300.000 m³ Wasser
entnommen. 1881
wurde der Stollen für die Erzgewinnung aufgegeben. Um die Trinkwasserversorgung
sicherer zu gewährleisten, wurden in den Iberger Stollensystemen Dämme
zur Erschließung weiterer Bergwässer errichtet, zudem wurden
die Holzpipen gegen gußeiserne Druckrohre ausgetauscht. Im Jahre
1885 übertrug der Hörder Bergwerks-und Hüttenverein den
Magdeburger Stollen in das Eigentum der Bergstadt Bad Grund. Seither dient
er – bis zum heutigen Tage ausschließlich der Wasserversorgung. Zur
Erhöhung des Wasservorrates und –drucks wurde 1911 etwa 280 m vom
Stollenmundloch entfernt eine Sperrmauer errichtet. Dieser Stauraum riegelt
das System Magdeburger Stollen vollständig ab. Das Wasser im Iberg
konnte danach um weitere fast 20 m ansteigen, bevor es aus anderen Stollen
überlaufend zutage trat. Der mit über 1 Mio. m³ berechnete
Wasservorrat dieser unterirdischen Talsperre reicht auch für die heutigen
Bedürfnisse der Wasserversorgung der Samtgemeinde Bad Grund (Harz).
Pro Jahr werden aus dem Magdeburger Stollen über 300.000 m³ Wasser
entnommen.
Text
Dr. Ralf Nielbock, Dipl.-Geologe
|
Die Geschichte
des „ Magdeburger Stollens“
Dient
seit Jahrhunderten der Trinkwasserversorgung
  Zweifellos
ist der Magdeburger Stollen das Herzstück der Wasserversorgung in
der Samtgemeinde. Er versorgt die gesamten Ortsbereiche von Bad Grund,
Windhausen, Teichhütte und Willensen mit Wasser. Auch weite Teile
des Flecken Gittelde, da dort das eigene Wasseraufkommen bei weitem nicht
ausreicht und Wasser von den Harzwasserwerken teuer eingekauft werden müsste. Zweifellos
ist der Magdeburger Stollen das Herzstück der Wasserversorgung in
der Samtgemeinde. Er versorgt die gesamten Ortsbereiche von Bad Grund,
Windhausen, Teichhütte und Willensen mit Wasser. Auch weite Teile
des Flecken Gittelde, da dort das eigene Wasseraufkommen bei weitem nicht
ausreicht und Wasser von den Harzwasserwerken teuer eingekauft werden müsste.
Über
den Magdeburger Stollen gibt es viel zu berichten.
Die Geschichte reicht in die Jahre um 1500 zurück
 Der
Wildemänner Pastor Hacke verfasste um 1570 herum in seiner Bergchronik
Aufzeichnungen über den Magdeburger Stollen. Die Bergstadt Bad Grund
hat diesem Stollen den Silberreichtum und damit verbunden auch die Bergfreiheit
zu verdanken. Der
Wildemänner Pastor Hacke verfasste um 1570 herum in seiner Bergchronik
Aufzeichnungen über den Magdeburger Stollen. Die Bergstadt Bad Grund
hat diesem Stollen den Silberreichtum und damit verbunden auch die Bergfreiheit
zu verdanken.
 Der
Stollen wurde 1527 aufgefahren. Aus ihm wurde das beim Bergbau anfallende
Bergwasser abgeführt, er war somit ein Wasserlösungsstollen.
Herzogin Elisabeth, 1503 auf der Stauffenburg zu Hause (1522 verstorben),
war eine große Förderin des Bergbaus. Der
Stollen wurde 1527 aufgefahren. Aus ihm wurde das beim Bergbau anfallende
Bergwasser abgeführt, er war somit ein Wasserlösungsstollen.
Herzogin Elisabeth, 1503 auf der Stauffenburg zu Hause (1522 verstorben),
war eine große Förderin des Bergbaus.
 Belegt
ist nicht, ob der Stollen bereits zu jener Zeit den Namen Magdeburger Stollen
führte oder erst in den Jahren 1527 bis 1528, als die Magdeburger
Kaufmannschaft ihn weiter ausbaute. Belegt
ist nicht, ob der Stollen bereits zu jener Zeit den Namen Magdeburger Stollen
führte oder erst in den Jahren 1527 bis 1528, als die Magdeburger
Kaufmannschaft ihn weiter ausbaute.
 Der
Hackeschen Chronik ist zu entnehmen, dass in den Jahren nach 1528 reger
Betrieb im Stollen herrschte und Silber abgebaut wurde. Von Jahr zu Jahr
wurde der Stollen erweitert und erstreckte sich mit der Zeit auf rund 1000
Meter. Der
Hackeschen Chronik ist zu entnehmen, dass in den Jahren nach 1528 reger
Betrieb im Stollen herrschte und Silber abgebaut wurde. Von Jahr zu Jahr
wurde der Stollen erweitert und erstreckte sich mit der Zeit auf rund 1000
Meter.
 Beim
Stollenbau wurde das Gebirgswasser abgefangen und dank der guten Qualität
den Haushalten und Hüttenbetrieben zur Verfügung gestellt. Zur
Ableitung gab es damals bereits Wasserleitungen aus Holz, den sogenannte
Pipen. Bei Ausschachtungsarbeiten, z.B. dem Bau der städtischen Kanalisation,
wurden häufig Reste dieser Wasserleitungen gefunden. Der heute noch
anzutreffende Familienname Piepenschneider erinnert an die Kunst des Pipen-Schneiders,
die Holzstämme aufbohrten und zusammenfügten, so dass in ihnen
Wasser fließen konnte. Beim
Stollenbau wurde das Gebirgswasser abgefangen und dank der guten Qualität
den Haushalten und Hüttenbetrieben zur Verfügung gestellt. Zur
Ableitung gab es damals bereits Wasserleitungen aus Holz, den sogenannte
Pipen. Bei Ausschachtungsarbeiten, z.B. dem Bau der städtischen Kanalisation,
wurden häufig Reste dieser Wasserleitungen gefunden. Der heute noch
anzutreffende Familienname Piepenschneider erinnert an die Kunst des Pipen-Schneiders,
die Holzstämme aufbohrten und zusammenfügten, so dass in ihnen
Wasser fließen konnte.
 Dank
des Magdeburger Stollens verfügten die Grundner über zwei Jahrhunderte
über ausgezeichnetes und ausreichendes Trinkwasser. Dank
des Magdeburger Stollens verfügten die Grundner über zwei Jahrhunderte
über ausgezeichnetes und ausreichendes Trinkwasser.
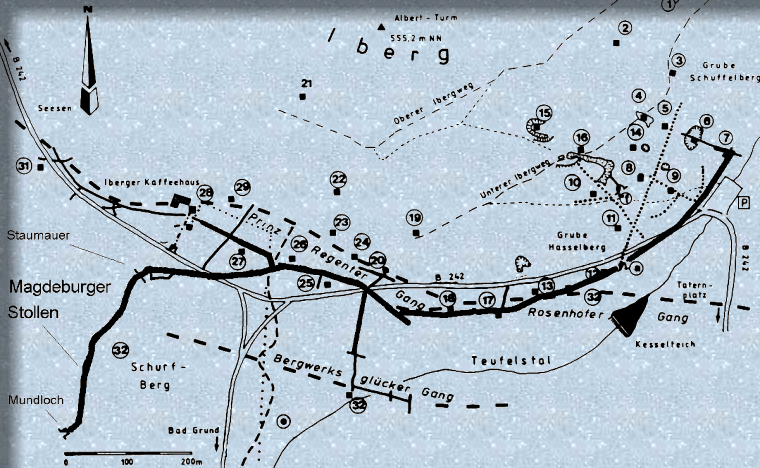
 Einzig
in den Jahren 1767 und 1823 war das Wasser durch vorangegangene Sommerdürren
und frostige und schneelose Winter knapp. Am 18.Oktober 1868 war der Magdeburger
Stollen allerdings völlig versiegt. Die Mühlen standen still
und die Straßenbrunnen hörten auf zu laufen. Der Grund: Vom
Knesebeckschacht aus war ein tiefer Stollen in den Iberg getrieben worden.
Dieser lag 40 Meter unter dem Magdeburger Stollen und hatte dessen Wasser
abgefangen. Einzig
in den Jahren 1767 und 1823 war das Wasser durch vorangegangene Sommerdürren
und frostige und schneelose Winter knapp. Am 18.Oktober 1868 war der Magdeburger
Stollen allerdings völlig versiegt. Die Mühlen standen still
und die Straßenbrunnen hörten auf zu laufen. Der Grund: Vom
Knesebeckschacht aus war ein tiefer Stollen in den Iberg getrieben worden.
Dieser lag 40 Meter unter dem Magdeburger Stollen und hatte dessen Wasser
abgefangen.
 Für
Abhilfe sollte eine neue Leitung sorgen. Von der Wiemannsbucht aus wurde
Wasser in die Stadt geführt. Offensichtlich aber minderer Qualität,
denn die Sterblichkeit nahm zu. Zehn Jahre dauerte dieser Zustand, dann
wurde der Stollenvortrieb vom Knesebeckschacht wieder abgemauert. Angenommen
wurde, dass das Wasser im Madgeburger Stollen schnell ansteigen würde.
Doch dem war nicht so. Für
Abhilfe sollte eine neue Leitung sorgen. Von der Wiemannsbucht aus wurde
Wasser in die Stadt geführt. Offensichtlich aber minderer Qualität,
denn die Sterblichkeit nahm zu. Zehn Jahre dauerte dieser Zustand, dann
wurde der Stollenvortrieb vom Knesebeckschacht wieder abgemauert. Angenommen
wurde, dass das Wasser im Madgeburger Stollen schnell ansteigen würde.
Doch dem war nicht so.
 Über
einen Zeitraum von 10 Jahren behalf die Bergstadt sich mit Wasser von minderer
Qualität, Erst im Juni 1878 erfolgte die Abschottung des Knesebecker
Suchortstollens mit einem unterirdischen Damm. Im Januar 1979, über
200 Tagen später, waren die unterirdischen Hohlräume des Ibergs
wieder mit Wasser erfüllt (nach damaligen Berechnungen 1.2 Mio. m³
Wasser) und flossen wieder aus dem Magdeburger Stollen. Über
einen Zeitraum von 10 Jahren behalf die Bergstadt sich mit Wasser von minderer
Qualität, Erst im Juni 1878 erfolgte die Abschottung des Knesebecker
Suchortstollens mit einem unterirdischen Damm. Im Januar 1979, über
200 Tagen später, waren die unterirdischen Hohlräume des Ibergs
wieder mit Wasser erfüllt (nach damaligen Berechnungen 1.2 Mio. m³
Wasser) und flossen wieder aus dem Magdeburger Stollen.
 Die
Abschließung des Seitendammes erfolgte endgültig am 15. Juni
1878. Erst am 5. Januar 1879, also nach 204 Tagen, floss das Wasser wieder.
Die Mühlen drehten sich wieder und die Brunnen in der Stadt lieferten
wieder einwandfreies Wasser. Die Tatsache, dass das Wasser 294 Tage brauchte,
um wieder so hochzusteigen, ließ Rückschlüsse auf die gewaltigen
Hohlräume zu, die sich im Innern des Ibergs befinden. Die
Abschließung des Seitendammes erfolgte endgültig am 15. Juni
1878. Erst am 5. Januar 1879, also nach 204 Tagen, floss das Wasser wieder.
Die Mühlen drehten sich wieder und die Brunnen in der Stadt lieferten
wieder einwandfreies Wasser. Die Tatsache, dass das Wasser 294 Tage brauchte,
um wieder so hochzusteigen, ließ Rückschlüsse auf die gewaltigen
Hohlräume zu, die sich im Innern des Ibergs befinden.
| Wasserwerker
Arthur Sachsalver (Bildmitte) erklärt Schulkindern die Trinkwasserversorgungsanlagen. |
 Nach
damaligen Berechungen des Bergingenieurs Rittershaus sollen es 1,2 Mio.
Kubikmeter Wasser gewesen sein, um diese Räume wieder zu füllen.
Neuerlichen gutachterlichen Berechnungen zufolge könnten rein theoretisch
im Jahresschnitt mindestens 1,2 Mio. Kubikmeter Wasser entnommen werden. Nach
damaligen Berechungen des Bergingenieurs Rittershaus sollen es 1,2 Mio.
Kubikmeter Wasser gewesen sein, um diese Räume wieder zu füllen.
Neuerlichen gutachterlichen Berechnungen zufolge könnten rein theoretisch
im Jahresschnitt mindestens 1,2 Mio. Kubikmeter Wasser entnommen werden.
 1881
wurde der Stollen für die Erzgewinnung aufgegeben. Um die Trinkwasserversorgung
sicherer zu gewährleisten wurden in den Iberger Stollensystemen Dämme
zur Erschließung weiterer Bergwässer errichtet, zudem wurden
die Holzpipen gegen gußeiserne Druckrohre ausgetauscht. Im Jahr 1885
übertrug der Hörder Bergwerks- und Hüttenverein den Magdeburger
Stollen in das Eigentum der Bergstadt Bad Grund. Seither dient er - bis
zum heutigen Tage - ausschließlich der Wasserversorgung. 1881
wurde der Stollen für die Erzgewinnung aufgegeben. Um die Trinkwasserversorgung
sicherer zu gewährleisten wurden in den Iberger Stollensystemen Dämme
zur Erschließung weiterer Bergwässer errichtet, zudem wurden
die Holzpipen gegen gußeiserne Druckrohre ausgetauscht. Im Jahr 1885
übertrug der Hörder Bergwerks- und Hüttenverein den Magdeburger
Stollen in das Eigentum der Bergstadt Bad Grund. Seither dient er - bis
zum heutigen Tage - ausschließlich der Wasserversorgung.
 Der
Stollen verläuft übrigens vom Mundloch am Hübichweg etwa
fünf Meter in den Berg hinein und biegt dann in Richtung Iberg ab.
Nach rund 280 Metern befindet sich eine Sperrmauer, hinter der das Trinkwasser
für die Bergstadt, die Gemeinde Windhausen, sowie Teile der Gemeinde
Gittelde, Badenhausen und Eisdorf gespeichert wird. Der
Stollen verläuft übrigens vom Mundloch am Hübichweg etwa
fünf Meter in den Berg hinein und biegt dann in Richtung Iberg ab.
Nach rund 280 Metern befindet sich eine Sperrmauer, hinter der das Trinkwasser
für die Bergstadt, die Gemeinde Windhausen, sowie Teile der Gemeinde
Gittelde, Badenhausen und Eisdorf gespeichert wird.
 Das
Wasser, öfters untersucht als zum Beispiel in Flaschen abgefülltes
Mineralwasser, ist von ausgezeichneter Qualität. Das
Wasser, öfters untersucht als zum Beispiel in Flaschen abgefülltes
Mineralwasser, ist von ausgezeichneter Qualität.
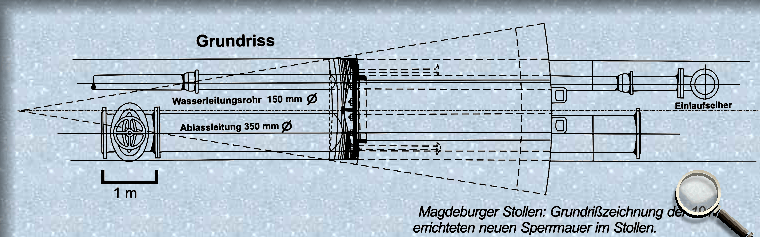
Der
mit über 1 Mio. m³ berechnete Wasser-vorrat dieser unterirdischen
Tal-sperre reicht auch für heutigen Bedürfnisse der Wasser-versorgung
der Samtgemeinde Bad Grund (Harz). Im Jahresmittel werden dem Magde-burger
Stollen ca. 300.000 m³ Wasser ent-nommen.
|