Baubeginn
des Ernst August Stollens vor 150 Jahren
Festvortrag
von Wilhelm Rögener, am 22. Juli 2001 in Gittelde
 Beginnen
möchte ich meine Ausführungen mit den sinnreichen Worten von
Abraham Gottlob Werner, der von 1775 bis 1817 Professor an der Bergakademie
Freiberg im Erzgebirge war, die lauten: Beginnen
möchte ich meine Ausführungen mit den sinnreichen Worten von
Abraham Gottlob Werner, der von 1775 bis 1817 Professor an der Bergakademie
Freiberg im Erzgebirge war, die lauten:
 Sollte
es uns nicht Pflicht sein, Sollte
es uns nicht Pflicht sein,
denen
uns folgenden Generationen
über
den ihnen überlassenen
theils
gangbaren, theils aufgelassenen Bergbau,
so
viel Licht als nur immer möglich ist,
aufzubehalten
und mitzuteilen.
 Anknüpfend
an diese Worte können wir heute glücklicherweise sagen, dass
sein Ausspruch Gehör gefunden hat. Denn vieles, was wir heute wissen,
ist „aufbehalten“ worden und liegt als festgeschriebene Mitteilung in Büchern,
Fachzeitschriften oder in zahlreichen Archiven vor, auf die wir immer wieder
Zugriff nehmen können, wenn besondere Anlässe dieses erfordern.
Ein besonderer Anlass ist der heutige Tag, denn fast genau vor 150 Jahren,
am 21. Juli 1851, wurde mit dem Bau des bedeutendsten und zugleich auch
letzten Großbauwerks im Oberharzer Gangerzrevier, dem Bau des Ernst-August-Stollens
begonnen, vor dessen Mundloch wir uns hier versammelt haben, um uns dieses
Tages zu erinnern. Anknüpfend
an diese Worte können wir heute glücklicherweise sagen, dass
sein Ausspruch Gehör gefunden hat. Denn vieles, was wir heute wissen,
ist „aufbehalten“ worden und liegt als festgeschriebene Mitteilung in Büchern,
Fachzeitschriften oder in zahlreichen Archiven vor, auf die wir immer wieder
Zugriff nehmen können, wenn besondere Anlässe dieses erfordern.
Ein besonderer Anlass ist der heutige Tag, denn fast genau vor 150 Jahren,
am 21. Juli 1851, wurde mit dem Bau des bedeutendsten und zugleich auch
letzten Großbauwerks im Oberharzer Gangerzrevier, dem Bau des Ernst-August-Stollens
begonnen, vor dessen Mundloch wir uns hier versammelt haben, um uns dieses
Tages zu erinnern.
Viel bewundertes
Bauwerk

|
Mundlochportal,
erbaut 1863/64
Höhe
der achtkantigen Sandsteinsäulen: 6m
Foto:
Wilhelm Rögener (1998) |
 Welche
Ausstrahlung der Ernst-August-Stollen schon kurz nach der Fertigstellung
im Jahre 1864 bereits gehabt hat, geht aus dem Vortrag des Oberingenieurs
Franz Rziha hervor, den er im Jahre 1872 vor dem Deutschen polytechnischen
Verein gehalten hat und in dem er sagte: Welche
Ausstrahlung der Ernst-August-Stollen schon kurz nach der Fertigstellung
im Jahre 1864 bereits gehabt hat, geht aus dem Vortrag des Oberingenieurs
Franz Rziha hervor, den er im Jahre 1872 vor dem Deutschen polytechnischen
Verein gehalten hat und in dem er sagte:
Unter
den hervorragendsten Werken der Technik, welche in unserer, an großartigen
Leistungen so reichen Zeit hergestellt worden sind, nimmt die Ausführung
des Ernst-August-Stollens am Harze eine der ersten Stellen ein. Dieser
Bau ist eine der Zierden unserer Zeit und eine mustergültige Zierde
auf dem viel umfassenden Gebiet der Technik. Es imponiert dieser Bau in
seiner äusseren Erscheinung durch seine Länge und durch die Tiefe,
in welcher er das Harzgebirge unterfährt, in seinem inneren Wesen
durch die aufregenden Schwierigkeiten, denen die Markscheiderarbeiten sich
unterordnen mussten und durch die Präzision und ruhige Sicherheit,
mittelst welcher die rein bergmännischen Arbeiten durchgeführt
worden sind.
 Vorgenanntes
soll nun einer näheren Betrachtung unterzogen werden. In Vorbereitung
zu diesem Stollenfest habe ich im Archiv des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld
nachgeforscht, um herauszufinden, was neben zahlreichen bekannten Veröffentlichungen
noch unbekannt zu sein scheint und besonderes Interesse bei Gitteldern,
deren Nachbarn sowie montanhistorisch Interessierten finden könnte. Vorgenanntes
soll nun einer näheren Betrachtung unterzogen werden. In Vorbereitung
zu diesem Stollenfest habe ich im Archiv des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld
nachgeforscht, um herauszufinden, was neben zahlreichen bekannten Veröffentlichungen
noch unbekannt zu sein scheint und besonderes Interesse bei Gitteldern,
deren Nachbarn sowie montanhistorisch Interessierten finden könnte.
Bau zwingend erforderlich
 Notwendig
wurde der Stollen, weil die Gruben des Oberharzer Bergbaus um Clausthal,
Zellerfeld, Wildemann und Bockswiese in Tiefen vorgedrungen waren, die
bei 400 m lagen und die damaligen technischen Einrichtungen zur Wasserhebung,
die sogenannten Wasserkünste, nicht mehr in der Lage waren die den
Gruben zufließenden Wasser zu heben. Notwendig
wurde der Stollen, weil die Gruben des Oberharzer Bergbaus um Clausthal,
Zellerfeld, Wildemann und Bockswiese in Tiefen vorgedrungen waren, die
bei 400 m lagen und die damaligen technischen Einrichtungen zur Wasserhebung,
die sogenannten Wasserkünste, nicht mehr in der Lage waren die den
Gruben zufließenden Wasser zu heben.
 Nicht
selten mussten Gruben über längere Zeiträume eingestellt
werden, Zeiträume die teilweise über ein Jahrhundert hinausgingen,
wie zum Beispiel bei den Vorgängergruben um den Meding Schacht, dessen
Lokalität dem hier anwesenden Personenkreis mit Sicherheit bekannt
sein dürfte.
Nicht
selten mussten Gruben über längere Zeiträume eingestellt
werden, Zeiträume die teilweise über ein Jahrhundert hinausgingen,
wie zum Beispiel bei den Vorgängergruben um den Meding Schacht, dessen
Lokalität dem hier anwesenden Personenkreis mit Sicherheit bekannt
sein dürfte.
 Wie
prekär die Lage der Gruben hinsichtlich ihrer Wasserlösungen
war, zeigt sich besonders daran, dass bereits vier Jahre nach Fertigstellung
des in 22-jähriger Bauzeit errichteten Tiefen Georg-Stollens eine
rund 100 m tiefere Wasserstrecke notwendig wurde, um in den Gruben des
Rosenhöfer, Burgstätter und einem Teil des Zellerfelder Reviers
weiter abbauen zu können. Durch diese neue Wasserstrecke wurde die
Voraussetzung geschaffen, dass mit den damaligen technischen Hilfsmitteln,
den Pumpenkünsten, die der Tiefen Wasserstrecke zufließenden
Wasser bis zum Niveau des Tiefen Georg-Stollens gehoben werden konnten. Wie
prekär die Lage der Gruben hinsichtlich ihrer Wasserlösungen
war, zeigt sich besonders daran, dass bereits vier Jahre nach Fertigstellung
des in 22-jähriger Bauzeit errichteten Tiefen Georg-Stollens eine
rund 100 m tiefere Wasserstrecke notwendig wurde, um in den Gruben des
Rosenhöfer, Burgstätter und einem Teil des Zellerfelder Reviers
weiter abbauen zu können. Durch diese neue Wasserstrecke wurde die
Voraussetzung geschaffen, dass mit den damaligen technischen Hilfsmitteln,
den Pumpenkünsten, die der Tiefen Wasserstrecke zufließenden
Wasser bis zum Niveau des Tiefen Georg-Stollens gehoben werden konnten.  Mit
dieser Tiefen Wasserstrecke, die von 1803 bis 1835 angelegt wurde und die
eine Länge von 6570 m hat , war bereits die erste Bauphase des späteren
Ernst-August-Stollens eingeleitet worden. Denn das Niveau dieser Tiefen
Wasserstrecke war Festpunkt bei der Planung für die Zutageführung
der Stollenwasser an einer noch unbestimmten Stelle am Harzrand, zwischen
Lasfelde und Gittelde. Mit
dieser Tiefen Wasserstrecke, die von 1803 bis 1835 angelegt wurde und die
eine Länge von 6570 m hat , war bereits die erste Bauphase des späteren
Ernst-August-Stollens eingeleitet worden. Denn das Niveau dieser Tiefen
Wasserstrecke war Festpunkt bei der Planung für die Zutageführung
der Stollenwasser an einer noch unbestimmten Stelle am Harzrand, zwischen
Lasfelde und Gittelde.
 Auf
der neben mir aufgestellten Tafel (siehe
Anlage 1) ist in der Zeichnung
der erste Bauabschnitt von 1803 bis 1835 durch eine grüne Kennzeichnung
dargestellt, der einem etwas schrägliegenden Y entspricht. Der untere
Schenkel des Y’s ist der Streckenverlauf im Rosenhöfer Revier, wo
ganz linksseitig unter dem Ottiliae-Schacht der Silber Seegener Schacht
liegt, der hier nicht ausgewiesen ist. Der obere Schenkel des Y’s ist zunächst
zu halbieren, wobei der linksseitige halbierte Schenkel der Streckenverlauf
im Zellerfelder Revier bis zum Schreibfeder Schacht ist und der andere
Halbierungsschenkel über den Scheitelpunkt hinaus bis zum Marienschacht
den Streckenverlauf im Burgstätter Revier ausweist. Auf
der neben mir aufgestellten Tafel (siehe
Anlage 1) ist in der Zeichnung
der erste Bauabschnitt von 1803 bis 1835 durch eine grüne Kennzeichnung
dargestellt, der einem etwas schrägliegenden Y entspricht. Der untere
Schenkel des Y’s ist der Streckenverlauf im Rosenhöfer Revier, wo
ganz linksseitig unter dem Ottiliae-Schacht der Silber Seegener Schacht
liegt, der hier nicht ausgewiesen ist. Der obere Schenkel des Y’s ist zunächst
zu halbieren, wobei der linksseitige halbierte Schenkel der Streckenverlauf
im Zellerfelder Revier bis zum Schreibfeder Schacht ist und der andere
Halbierungsschenkel über den Scheitelpunkt hinaus bis zum Marienschacht
den Streckenverlauf im Burgstätter Revier ausweist.
Auffahrung des
Stollens
 Bei
dem zweiten Bauabschnitt handelt es sich um den Zeitraum von 1851 bis 1864,
also um jenen Zeitraum, der in allen Veröffentlichungen als Auffahrungszeitraum
festgeschrieben ist. Dieser ist in der Zeichnung rot ausgewiesen. Bei
dem zweiten Bauabschnitt handelt es sich um den Zeitraum von 1851 bis 1864,
also um jenen Zeitraum, der in allen Veröffentlichungen als Auffahrungszeitraum
festgeschrieben ist. Dieser ist in der Zeichnung rot ausgewiesen.
  Als
dritter Bauabschnitt ist der Zeitraum nach 1864 bis 1880 zu bezeichnen,
der in der Zeichnung braun gekennzeichnet ist, der sich im wesentlichen
auf das Gebiet Schreibfeder Schacht gegen Norden auf Bockswiese zu und
darüber hinaus bis Lautenthal und weiter bis in den Bereich des Sternplatzes
(Pass zwischen Lautenthal und Seesen) erstreckt. Abzweigungen von Lautenthal
in Richtung Wildemann und vom Ernst-August-Schacht in Wildemann in RichtungLautenthal
sind weitere Ausweitungen des Stollensystems. Als
dritter Bauabschnitt ist der Zeitraum nach 1864 bis 1880 zu bezeichnen,
der in der Zeichnung braun gekennzeichnet ist, der sich im wesentlichen
auf das Gebiet Schreibfeder Schacht gegen Norden auf Bockswiese zu und
darüber hinaus bis Lautenthal und weiter bis in den Bereich des Sternplatzes
(Pass zwischen Lautenthal und Seesen) erstreckt. Abzweigungen von Lautenthal
in Richtung Wildemann und vom Ernst-August-Schacht in Wildemann in RichtungLautenthal
sind weitere Ausweitungen des Stollensystems.
 In
die dritte Bauphase fällt auch das Iberger Flügelort, das vom
Knesebeck-Schacht aus von 1859 bis 1869 zur Erzerkundung im Iberg aufgefahren
wurde. Werden alle drei hier vorgetragenen Bauabschnitte zusammengefasst,
so beträgt die Gesamtlänge des Stollens ca. 26.000 m, prozentual
aufgegliedert stellt sich die Gesamtauffahrung wie folgt dar: In
die dritte Bauphase fällt auch das Iberger Flügelort, das vom
Knesebeck-Schacht aus von 1859 bis 1869 zur Erzerkundung im Iberg aufgefahren
wurde. Werden alle drei hier vorgetragenen Bauabschnitte zusammengefasst,
so beträgt die Gesamtlänge des Stollens ca. 26.000 m, prozentual
aufgegliedert stellt sich die Gesamtauffahrung wie folgt dar:
In
der ersten Bauphase wurden bereits 25 %, in der zweiten 62 % und in der
dritten 13 % der Gesamtlänge aufgefahren.
 Nicht
so festlich wie beim Auffahrungsbeginn des Tiefen Georg-Stollens am 26.
Juli 1777 wurde der Beginn des Ernst-August-Stollens am 21. Juli 1851begangen..Bei
meinen Nachforschungen habe ich nur herausfinden können, dass am 21.
Juli 1851 mit einer Querschlagserweiterung vom Schreibfeder Schacht aus
im Zellerfelder Revier mit dem Stollenbau begonnen wurde. Festlich wurde
nur die Fertigstellung des Stollens im Jahre 1864 begangen, woran dann,
wie bei solchen Anlässen üblich, die gesamte Oberharzer Bevölkerung
teilnahm. Nicht
so festlich wie beim Auffahrungsbeginn des Tiefen Georg-Stollens am 26.
Juli 1777 wurde der Beginn des Ernst-August-Stollens am 21. Juli 1851begangen..Bei
meinen Nachforschungen habe ich nur herausfinden können, dass am 21.
Juli 1851 mit einer Querschlagserweiterung vom Schreibfeder Schacht aus
im Zellerfelder Revier mit dem Stollenbau begonnen wurde. Festlich wurde
nur die Fertigstellung des Stollens im Jahre 1864 begangen, woran dann,
wie bei solchen Anlässen üblich, die gesamte Oberharzer Bevölkerung
teilnahm.
 Nach
und nach erfolgte von 10 Punkten aus die Auffahrung in jeweils zwei entgegengesetzte
Richtungen. Der gesamte Stollenbereich war in 18 Angriffsörter aufgeteilt,
diese wiederum unterteilt in Stollenörter und Gegenstollenörter,
die sich dadurch unterschieden, dass das Stollenort ansteigend und das
Gegenstollenort fallend aufgefahren wurde. Nach
und nach erfolgte von 10 Punkten aus die Auffahrung in jeweils zwei entgegengesetzte
Richtungen. Der gesamte Stollenbereich war in 18 Angriffsörter aufgeteilt,
diese wiederum unterteilt in Stollenörter und Gegenstollenörter,
die sich dadurch unterschieden, dass das Stollenort ansteigend und das
Gegenstollenort fallend aufgefahren wurde.
Glanzleistung
der Bergleute
 Der
Stollen hat über die gesamte Länge einen annährend gleichen
Querschnitt. So beträgt die Höhe 1 5/16 Lachter, dieses sind
2,52 m, eine Breite von 7/8 Lachter, dieses sind 1,68 m. Aus diesen Maßen
errechnet sind ein Querschnitt von 4,23 m². Das Stollengefälle
beträgt 5 Zoll auf 100 Lachter , dieses entspricht einem Gefälle
von 1 : 1580, allgemein ausgedrückt heißt das, auf 1580 m Stollenlänge
kommt 1 m Gefälle. Bezogen auf die 10429 Stollenmeter vom Schreibfeder
Schacht bis zum Stollenmundloch in Gittelde sind es 6,60 m Gefälleunterschied.
Zur bildlichen Vorstellung dieses Gefälles sei hier auf die beiden
Säulen am Mundloch hingewiesen, die vom Boden bis zur Oberkante der
Zinnen eine Höhe von 6 m haben. Der
Stollen hat über die gesamte Länge einen annährend gleichen
Querschnitt. So beträgt die Höhe 1 5/16 Lachter, dieses sind
2,52 m, eine Breite von 7/8 Lachter, dieses sind 1,68 m. Aus diesen Maßen
errechnet sind ein Querschnitt von 4,23 m². Das Stollengefälle
beträgt 5 Zoll auf 100 Lachter , dieses entspricht einem Gefälle
von 1 : 1580, allgemein ausgedrückt heißt das, auf 1580 m Stollenlänge
kommt 1 m Gefälle. Bezogen auf die 10429 Stollenmeter vom Schreibfeder
Schacht bis zum Stollenmundloch in Gittelde sind es 6,60 m Gefälleunterschied.
Zur bildlichen Vorstellung dieses Gefälles sei hier auf die beiden
Säulen am Mundloch hingewiesen, die vom Boden bis zur Oberkante der
Zinnen eine Höhe von 6 m haben.
  Dieses
vorgegebene Gefälle bei den 18 Örtern haargenau einzuhalten erforderte
sowohl von den Bergleuten als auch von den markscheiderisch tätigen
Personen ein hohes Maß an Präzision. So ist der für die
markscheiderischen Arbeiten verantwortliche Oberbergamtsmarkscheider und
Bergrat Eduard Borchers, der in Wulften geboren wurde und somit ein Kind
unserer Heimat ist, durch seine mustergültige und einmalige Leistung
bei den Vermessungsarbeiten in die Geschichte der Messkunst für ewige
Zeiten eingegangen. Ihm gebührt höchster Respekt, denn solch
ein Bauwerk sowohl in der Richtung als auch in der Höhe mit Fehlertoleranzen
von 1 bzw. 0,5 Zoll zu erstellen ist und bleibt eine herausragende Leistung.
Anerkennung findet auch die bergmännische Leistung, die darin zu sehen
ist, dass der Stollen in einer Bauzeit von nur 12 Jahren und 11 Monaten
aufgefahren werden konnte, wogegen anfangs 22 Jahre eingeplant waren. Durch
Optimierung der von Hand ausgeführten Bohrarbeit wurde dieses möglich.
Denn zu Beginn der Stollenauffahrung wurden in der Woche 135 Bohrlöcher
erstellt, am Ende waren es 378. Begonnen hatte man mit der 5-Tagewoche,
am Ende wurde an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Vor einem Ort waren immer
3 Mann pro Schicht eingesetzt. Wurde anfangs in 3 Schichten zu 8 Stunden
am Tag gearbeitet, waren es am Ende ab 1861 4 Schichten zu 6 Stunden. Dieses
vorgegebene Gefälle bei den 18 Örtern haargenau einzuhalten erforderte
sowohl von den Bergleuten als auch von den markscheiderisch tätigen
Personen ein hohes Maß an Präzision. So ist der für die
markscheiderischen Arbeiten verantwortliche Oberbergamtsmarkscheider und
Bergrat Eduard Borchers, der in Wulften geboren wurde und somit ein Kind
unserer Heimat ist, durch seine mustergültige und einmalige Leistung
bei den Vermessungsarbeiten in die Geschichte der Messkunst für ewige
Zeiten eingegangen. Ihm gebührt höchster Respekt, denn solch
ein Bauwerk sowohl in der Richtung als auch in der Höhe mit Fehlertoleranzen
von 1 bzw. 0,5 Zoll zu erstellen ist und bleibt eine herausragende Leistung.
Anerkennung findet auch die bergmännische Leistung, die darin zu sehen
ist, dass der Stollen in einer Bauzeit von nur 12 Jahren und 11 Monaten
aufgefahren werden konnte, wogegen anfangs 22 Jahre eingeplant waren. Durch
Optimierung der von Hand ausgeführten Bohrarbeit wurde dieses möglich.
Denn zu Beginn der Stollenauffahrung wurden in der Woche 135 Bohrlöcher
erstellt, am Ende waren es 378. Begonnen hatte man mit der 5-Tagewoche,
am Ende wurde an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Vor einem Ort waren immer
3 Mann pro Schicht eingesetzt. Wurde anfangs in 3 Schichten zu 8 Stunden
am Tag gearbeitet, waren es am Ende ab 1861 4 Schichten zu 6 Stunden.
 Die
Stollenleitung lag zu Anfang in den Händen des Berghauptmanns Gerlach
Ernst von dem Knesebeck und nach dessen Tod im Jahre 1859 war Carl August
von Linsingen verantwortlich. Als nächster stand der Geheime Bergrat
Hermann Koch, Vater vom Nobelpreiträger Robert Koch, den Berghauptleuten
zur Seite, der wiederum durch die Bezirksvorsteher der Bergbezirke Zellerfeld
und Clausthal, die Bergmeister Pape und Töpfer, unterstützt wurde. Die
Stollenleitung lag zu Anfang in den Händen des Berghauptmanns Gerlach
Ernst von dem Knesebeck und nach dessen Tod im Jahre 1859 war Carl August
von Linsingen verantwortlich. Als nächster stand der Geheime Bergrat
Hermann Koch, Vater vom Nobelpreiträger Robert Koch, den Berghauptleuten
zur Seite, der wiederum durch die Bezirksvorsteher der Bergbezirke Zellerfeld
und Clausthal, die Bergmeister Pape und Töpfer, unterstützt wurde.
 Namensgeber
des Stollens ist der von 1837 bis 1851 regierende König Ernst August
von Hannover. Er gab noch kurz vor seinem Tod, im Jahre 1851, dem Stollen
seinen Namen. Namensgeber
des Stollens ist der von 1837 bis 1851 regierende König Ernst August
von Hannover. Er gab noch kurz vor seinem Tod, im Jahre 1851, dem Stollen
seinen Namen.
Suche nach dem
günstigsten Stollenansatzpunkt
 Komme
ich nun zum zweiten Teil des Vortrags, indem besonders aufgezeigt werden
soll, wie es zu der Festlegung des Mundloches gekommen ist, wie die Planungsphase
verlaufen ist und wie das Umfeld des Fleckens Gittelde in den berühmten
Stollenbau des Oberharzer Bergbaus eingebunden wurde. Komme
ich nun zum zweiten Teil des Vortrags, indem besonders aufgezeigt werden
soll, wie es zu der Festlegung des Mundloches gekommen ist, wie die Planungsphase
verlaufen ist und wie das Umfeld des Fleckens Gittelde in den berühmten
Stollenbau des Oberharzer Bergbaus eingebunden wurde.
 Um
den günstigsten Stollenansatzpunkt herauszufinden, wurden bei der
Planung, 7 Stollenansatzpunkte am Harzrand zwischen Lasfelde und Gittelde
in Vorschlag gebracht. Von diesen 7 Ansatzpunkten war einer bereits beim
Bau des Tiefen Georg-Stollens vorgeschlagen worden. Den Entwurf hierzu
hat der Markscheider Samuel Gottlieb Rausch im August 1775 in einem erstklassigen
Riss dargestellt. Er liegt sowohl im Archiv der Preußag in Goslar
als auch im Oberbergamt in Clausthal vor und beinhaltet zusätzlich
noch eine eingehende textliche Erläuterung. Wäre diese hier angeführte
Planung damals zur Durchführung gekommen, wäre die Entwicklung
eines Wasserlösungsstollensystems für das gesamte Oberharzer
Bergbaurevier ganz anders verlaufen als sie später verlaufen ist.
Denn dieses bei Lasfelde auserwählte Mundloch, in Flussnähe der
Söse harzseitig gelegen, hätte in etwa der topographischen Höhenlage
späterer Ansatzpunkte entsprochen und bereits damals wäre das
angestrebte Niveau des später angelegten Ernst- August-Stollens erreicht
worden, siehe
Bild 2.
Wieder ins Gespräch kam dann die gleiche Planung im Jahre 1825/26,
um einen Anschluss an die Tiefe Wasserstrecke im Rosenhöfer Revier
herzustellen. Für die Durchführung dieses Stollenprojekts war
ein englisches Unternehmen im Gespräch. Jedoch scheiterte das Projekt
daran, dass nach Kostenvergleichszahlen für Stollenauffahrungen das
englische Unternehmen zu hohe Kostenansätze im Kostenvoranschlag aufgeführt
hatte. Um
den günstigsten Stollenansatzpunkt herauszufinden, wurden bei der
Planung, 7 Stollenansatzpunkte am Harzrand zwischen Lasfelde und Gittelde
in Vorschlag gebracht. Von diesen 7 Ansatzpunkten war einer bereits beim
Bau des Tiefen Georg-Stollens vorgeschlagen worden. Den Entwurf hierzu
hat der Markscheider Samuel Gottlieb Rausch im August 1775 in einem erstklassigen
Riss dargestellt. Er liegt sowohl im Archiv der Preußag in Goslar
als auch im Oberbergamt in Clausthal vor und beinhaltet zusätzlich
noch eine eingehende textliche Erläuterung. Wäre diese hier angeführte
Planung damals zur Durchführung gekommen, wäre die Entwicklung
eines Wasserlösungsstollensystems für das gesamte Oberharzer
Bergbaurevier ganz anders verlaufen als sie später verlaufen ist.
Denn dieses bei Lasfelde auserwählte Mundloch, in Flussnähe der
Söse harzseitig gelegen, hätte in etwa der topographischen Höhenlage
späterer Ansatzpunkte entsprochen und bereits damals wäre das
angestrebte Niveau des später angelegten Ernst- August-Stollens erreicht
worden, siehe
Bild 2.
Wieder ins Gespräch kam dann die gleiche Planung im Jahre 1825/26,
um einen Anschluss an die Tiefe Wasserstrecke im Rosenhöfer Revier
herzustellen. Für die Durchführung dieses Stollenprojekts war
ein englisches Unternehmen im Gespräch. Jedoch scheiterte das Projekt
daran, dass nach Kostenvergleichszahlen für Stollenauffahrungen das
englische Unternehmen zu hohe Kostenansätze im Kostenvoranschlag aufgeführt
hatte.
  Eine
Stollenführung von Lasfelde aus war damit gänzlich abgeschrieben
worden. Neu in die Überlegungen für die Stollenführung mit
aufgenommen wurde der ab 1831 wieder in Betrieb genommene Bergbau der Grube
Hülfe Gottes am Todtemanns Berg bei Grund, der den Akten entnehmend
sehr hoffnungsvoll zu verlaufen schien. So waren die weiteren Planungen
der Stollenführung von der Grube Hülfe Gottes aus auf das naheliegende
Harzvorland und auf das Gebiet von Clausthal sowie Zellerfeld zu ausgerichtet
worden. Für die Stollenführung aus dem Raum Clausthal und Zellerfeld
standen bis zur Grube Hülfe Gottes zwei Planungsvarianten an. Variante
1, den Stollenvortrieb vom Silber Seegener Schacht aus über das Silbernaaler
Revier nach Grund zu führen (in Erinnerung gebracht es ist dieses
das Gebiet um den Meding Schacht) oder die Variante 2, die Stollenführung
so anzulegen, wie sie letztendlich durchgeführt wurde, das heißt,
den Stollen vom Schreibfeder Schacht aus über Wildemann nach Grund
zu aufzufahren. Eine
Stollenführung von Lasfelde aus war damit gänzlich abgeschrieben
worden. Neu in die Überlegungen für die Stollenführung mit
aufgenommen wurde der ab 1831 wieder in Betrieb genommene Bergbau der Grube
Hülfe Gottes am Todtemanns Berg bei Grund, der den Akten entnehmend
sehr hoffnungsvoll zu verlaufen schien. So waren die weiteren Planungen
der Stollenführung von der Grube Hülfe Gottes aus auf das naheliegende
Harzvorland und auf das Gebiet von Clausthal sowie Zellerfeld zu ausgerichtet
worden. Für die Stollenführung aus dem Raum Clausthal und Zellerfeld
standen bis zur Grube Hülfe Gottes zwei Planungsvarianten an. Variante
1, den Stollenvortrieb vom Silber Seegener Schacht aus über das Silbernaaler
Revier nach Grund zu führen (in Erinnerung gebracht es ist dieses
das Gebiet um den Meding Schacht) oder die Variante 2, die Stollenführung
so anzulegen, wie sie letztendlich durchgeführt wurde, das heißt,
den Stollen vom Schreibfeder Schacht aus über Wildemann nach Grund
zu aufzufahren.
 Jetzt
galt es den günstigsten Stollenansatzpunkt im Harzvorland herauszufinden.
In den 6 der von 7 übrig gebliebenen Entwürfen waren die Stollenansatzpunkte
so vorgesehen, dass die topographische Höhenlage jedes möglichen
Ansatzpunktes bei ca. 190 m NN zu liegen hatte. (Siehe
Anlage 2) Jetzt
galt es den günstigsten Stollenansatzpunkt im Harzvorland herauszufinden.
In den 6 der von 7 übrig gebliebenen Entwürfen waren die Stollenansatzpunkte
so vorgesehen, dass die topographische Höhenlage jedes möglichen
Ansatzpunktes bei ca. 190 m NN zu liegen hatte. (Siehe
Anlage 2)
 Bei
Badenhausen und zwar in der Sülpke war zunächst ein Ansatzpunkt
in Vorschlag gebracht worden. Vom Ansatzpunkt bei Badenhausen in Richtung
auf Gittelde zu war der nächste in der Gemarkung Windhausen, in Nähe
des Schlungbaches, in etwa dort, wo die Schnellstraße den Schlungbach
kreuzt. Weitere Ansatzpunkte in Richtung auf Gittelde waren, bezogen auf
heutige Orientierungspunkte: Bei
Badenhausen und zwar in der Sülpke war zunächst ein Ansatzpunkt
in Vorschlag gebracht worden. Vom Ansatzpunkt bei Badenhausen in Richtung
auf Gittelde zu war der nächste in der Gemarkung Windhausen, in Nähe
des Schlungbaches, in etwa dort, wo die Schnellstraße den Schlungbach
kreuzt. Weitere Ansatzpunkte in Richtung auf Gittelde waren, bezogen auf
heutige Orientierungspunkte:
in Bahnhofsnähe
weiter
das heutige Grundstück von Rundstedt
des weiteren
an der Stelle, wo wir uns hier befinden
und als
letzter einer am unteren Grundweg.
 Jede
der vorgeschlagenen 6 Stollenführungen war geradlinig auf den Hülfe
Gottes Schacht zu ausgerichtet. Wie in der Planung vorgesehen, wurde die
gewählte Stollenführung, also die von diesem Mundloch aus, auch
geradlinig auf den Hülfe Gottes Schacht zu ausgeführt (Siehe
Anlage 3). Dieser Ansatzpunkt
hier wurde gewählt, weil zwei günstige Straßenanbindungen,
die Thüringer Straße und eine von dieser nach Windhausen abzweigende
Straße direkt am geplanten Mundloch vorbei führen. Die Auffahrungslänge
zwischen Mundloch und Hülfe Gottes Schacht beträgt 1335 Lachter
entsprechend 2563 m. Mitte der 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde
die geradlinige Stollenführung durch eine Verumbruchung umgelegt,
die in etwa bei 560 m vom Mundloch aus begann. Jede
der vorgeschlagenen 6 Stollenführungen war geradlinig auf den Hülfe
Gottes Schacht zu ausgerichtet. Wie in der Planung vorgesehen, wurde die
gewählte Stollenführung, also die von diesem Mundloch aus, auch
geradlinig auf den Hülfe Gottes Schacht zu ausgeführt (Siehe
Anlage 3). Dieser Ansatzpunkt
hier wurde gewählt, weil zwei günstige Straßenanbindungen,
die Thüringer Straße und eine von dieser nach Windhausen abzweigende
Straße direkt am geplanten Mundloch vorbei führen. Die Auffahrungslänge
zwischen Mundloch und Hülfe Gottes Schacht beträgt 1335 Lachter
entsprechend 2563 m. Mitte der 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde
die geradlinige Stollenführung durch eine Verumbruchung umgelegt,
die in etwa bei 560 m vom Mundloch aus begann.
Beginn der Stollenauffahrung
 Angesprochen
werden muss jetzt noch, wann von Gittelde aus mit dem Anschlagen des Stollens
begonnen wurde. Angesprochen
werden muss jetzt noch, wann von Gittelde aus mit dem Anschlagen des Stollens
begonnen wurde. 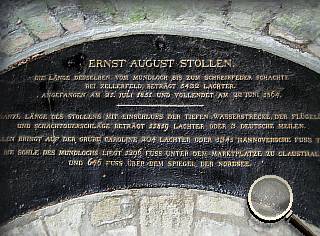 Wie
schon mehrmals genannt, wurde der Stollen am 21. Juli 1851 begonnen, nimmt
man aber die gängige Literatur mit den entsprechenden Tabellen zur
Hand, so stellt man fest, dass von Gittelde aus erst am 09. August 1853
mit der Auffahrung begonnen wurde. Der Grund für diese Zeitdifferenz
ist darin zu sehen, dass der Geländezukauf vor dem Stollenmundloch
nicht ganz glatt verlaufen ist. Wie
schon mehrmals genannt, wurde der Stollen am 21. Juli 1851 begonnen, nimmt
man aber die gängige Literatur mit den entsprechenden Tabellen zur
Hand, so stellt man fest, dass von Gittelde aus erst am 09. August 1853
mit der Auffahrung begonnen wurde. Der Grund für diese Zeitdifferenz
ist darin zu sehen, dass der Geländezukauf vor dem Stollenmundloch
nicht ganz glatt verlaufen ist.
 So
war bereits im August 1851 ein Geländeankauf von 5 Morgen und 11 1/2
Quadratruthen am Anger im Gespräch. Es wurde mit dem Gittelder Ortsvorsteher
Giesecke verhandelt, der einen Kaufpreis von 300 Rthl. pro Morgen ansprach,
der aber auch mitteilte, dass Verkaufsverhandlungen nur unter Beteiligung
von 20 Interessenten des adligen Junkernhofes und einer Teilungskommission
unter Vorsitz des Amts Assessors Griebenkerl aus Seesen geführt werden
können. Ein Ergebnis wurde damals nicht erreicht. So wurde auf höherer
Ebene und zwar erst am 5. August 1853 der endgültige Kaufvertrag für
den Grundtückserwerb abgeschlossen. Und zwar wurde die bereits 1851
im Gespräch gewesene Fläche durch den Bergfiskus in Clausthal
erworben. Anwesend bei der letzten Verkaufsverhandlung waren: So
war bereits im August 1851 ein Geländeankauf von 5 Morgen und 11 1/2
Quadratruthen am Anger im Gespräch. Es wurde mit dem Gittelder Ortsvorsteher
Giesecke verhandelt, der einen Kaufpreis von 300 Rthl. pro Morgen ansprach,
der aber auch mitteilte, dass Verkaufsverhandlungen nur unter Beteiligung
von 20 Interessenten des adligen Junkernhofes und einer Teilungskommission
unter Vorsitz des Amts Assessors Griebenkerl aus Seesen geführt werden
können. Ein Ergebnis wurde damals nicht erreicht. So wurde auf höherer
Ebene und zwar erst am 5. August 1853 der endgültige Kaufvertrag für
den Grundtückserwerb abgeschlossen. Und zwar wurde die bereits 1851
im Gespräch gewesene Fläche durch den Bergfiskus in Clausthal
erworben. Anwesend bei der letzten Verkaufsverhandlung waren:
Der Berghauptmann
von dem Knesebeck aus Clausthal,
der Bergrat
Koch aus Clausthal,
der Finanzdirektor
Thielen aus Braunschweig,
der Kreisdirektor
Culemann aus Gandersheim und
der Gemeindevorsteher
Giesecke aus Gittelde.
 Festzuhalten
bleibt, dass 4 Tage später nach der Verhandlung, am 9. August 1853,
mit dem Stollenbau von Gittelde aus begonnen wurde. Festzuhalten
bleibt, dass 4 Tage später nach der Verhandlung, am 9. August 1853,
mit dem Stollenbau von Gittelde aus begonnen wurde. |


